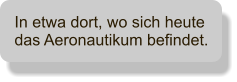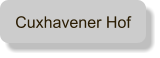Seite 3
Inhaltsverzeichnis
Seite 3
•
Nettelbeck, Joachim - Eine Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgezeichnet
•
Rabener, Gottfried Wilhelm - Satiren
•
Rast, Freiherr Ferdinand von - Das Leben des Freiherrn Ferdinand von Rast
•
Sachse, Joachim Christoph - Der deutsche Gil Blas
•
Schröder, Bernhard - Erinnerungen 1927 - 1945
•
Seitel, Willy - Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
Seite 4
•
Trinius, August - Wenn die Sonne sinkt
•
Turgenev, Ivan Sergejevich - Faust - Erzählung in neun Briefen
Seite 5
•
Willkomm, Ernst - Reeder und Matrose
______________________________________________________________________________________
Joachim Nettelbeck: Eine Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgezeichnet
Zu diesem Verdruß gesellte sich, sobald ich endlich in See gelangt war, ein anderer und noch größerer. Mein Schiffsvolk nämlich, durchaus dem Suff ergeben, wollte an der Gelegenheit nichts versäumen, den Weinfäs-
Schiffsvolk nämlich, durchaus dem Suff ergeben, wollte an der Gelegenheit nichts versäumen, den Weinfäs- sern, die einen Teil unsrer Ladung ausmachten, aufs fleißigste zuzusprechen. Als ich dem zu wehren
sern, die einen Teil unsrer Ladung ausmachten, aufs fleißigste zuzusprechen. Als ich dem zu wehren gedachte, rottierten sich die Kerle zusammen, schlugen mit Gewalt die Luken auf, zapften die Oxhöfte an
gedachte, rottierten sich die Kerle zusammen, schlugen mit Gewalt die Luken auf, zapften die Oxhöfte an und ließen den Wein stromweise in ihre Wassereimer und Hüte rinnen. In wenig Stunden hatte sich alles toll
und ließen den Wein stromweise in ihre Wassereimer und Hüte rinnen. In wenig Stunden hatte sich alles toll und voll gesoffen. Von nun an hatte es aber auch mit allem Kommando ein Ende. Die Vollzapfe waren wie
und voll gesoffen. Von nun an hatte es aber auch mit allem Kommando ein Ende. Die Vollzapfe waren wie wütend und ich und der Steuermann unsers Lebens unter ihnen nicht mehr sicher.
wütend und ich und der Steuermann unsers Lebens unter ihnen nicht mehr sicher. Und so ging es fortan einen Tag wie den andern. Wir beide mochten zusehen, wie wir konnten, damit das
Und so ging es fortan einen Tag wie den andern. Wir beide mochten zusehen, wie wir konnten, damit das Schiff wenigstens einigermaßen seinen Kurs hielt. War es auch geradezu nicht Rebellion zu nennen, so
Schiff wenigstens einigermaßen seinen Kurs hielt. War es auch geradezu nicht Rebellion zu nennen, so blieb es doch ein wüstes Tollmannsleben, wobei weder gute noch böse Worte anschlugen, und wir paar
blieb es doch ein wüstes Tollmannsleben, wobei weder gute noch böse Worte anschlugen, und wir paar Vernünftige die größte Gefahr und Not vor Augen sahen, so oft Segel sollten beigesetzt oder eingenommen
Vernünftige die größte Gefahr und Not vor Augen sahen, so oft Segel sollten beigesetzt oder eingenommen werden. Endlich half Gott wiewohl unter Angst und Schrecken, daß wir bei Kuxhaven vor der Mündung der
werden. Endlich half Gott wiewohl unter Angst und Schrecken, daß wir bei Kuxhaven vor der Mündung der Elbe anlangten. Gerade hier aber konnte ich mich auch mit diesen Menschen unmöglich weiter wagen, da
Elbe anlangten. Gerade hier aber konnte ich mich auch mit diesen Menschen unmöglich weiter wagen, da man in den Eugen des Stromes immerfort zu lavieren hatte, oder die Anker fallen lassen mußte. Ich be-
man in den Eugen des Stromes immerfort zu lavieren hatte, oder die Anker fallen lassen mußte. Ich be- schloß also, an Land zu gehen und acht oder zehn tüchtige Menschen anzunehmen, die mir nach Hamburg
schloß also, an Land zu gehen und acht oder zehn tüchtige Menschen anzunehmen, die mir nach Hamburg hinauf helfen sollten.
hinauf helfen sollten. Zufällig trat ich in dem Örtchen zu einem Barbier ein, um mich unter sein Schermesser zu liefern. Ich ward
Zufällig trat ich in dem Örtchen zu einem Barbier ein, um mich unter sein Schermesser zu liefern. Ich ward aber nicht bloß geschoren, sondern auch daneben so kunstmäßig ausgefragt, daß mir die Not und das
aber nicht bloß geschoren, sondern auch daneben so kunstmäßig ausgefragt, daß mir die Not und das Elend, worin ich mit meinem gar nicht mehr zu ernüchternden Schiffsvolke steckte, gar bald in lauter Klage
Elend, worin ich mit meinem gar nicht mehr zu ernüchternden Schiffsvolke steckte, gar bald in lauter Klage über die Lippen trat. Vor allem erwähnte ich zweier Kerle, die sich im eigentlichen Sinne rasend gesof-fen zu
über die Lippen trat. Vor allem erwähnte ich zweier Kerle, die sich im eigentlichen Sinne rasend gesof-fen zu haben schienen und ganz wie von Sinn und Verstand gekommen wären. – »Nun, der Verstand wäre ihnen
haben schienen und ganz wie von Sinn und Verstand gekommen wären. – »Nun, der Verstand wäre ihnen wohl leicht wieder einzutrichtern«, versetzte der Barbier mit einer schlauen Miene, »wenn ihnen nur zuvor
wohl leicht wieder einzutrichtern«, versetzte der Barbier mit einer schlauen Miene, »wenn ihnen nur zuvor der Unverstand und die tollen Affekten hinlänglich abgezapft worden.« – Er meinte nämlich (wie er sich
der Unverstand und die tollen Affekten hinlänglich abgezapft worden.« – Er meinte nämlich (wie er sich darüber auf mein Befragen näher erklärte), ein tüchtiger Aderlaß bis zur Ohnmacht sollte diese bestialische
darüber auf mein Befragen näher erklärte), ein tüchtiger Aderlaß bis zur Ohnmacht sollte diese bestialische Tollheit, wenn sie bloß im Suff ihren Grund hatte, schon zur Ordnung bringen.
Tollheit, wenn sie bloß im Suff ihren Grund hatte, schon zur Ordnung bringen. Zwar nehm ich von diesem medizinischen Gutachten keine weitere Notiz; doch als ich am andern Morgen
Zwar nehm ich von diesem medizinischen Gutachten keine weitere Notiz; doch als ich am andern Morgen wieder an Land wollte, um die gedungenen Leute an Bord zu nehmen, fiel mir der Barbier und sein Heilmittel
wieder an Land wollte, um die gedungenen Leute an Bord zu nehmen, fiel mir der Barbier und sein Heilmittel wieder ein. Mag es den Versuch gelten! dacht' ich, und wandte mich in unbefangener Vertraulichkeit an die
wieder ein. Mag es den Versuch gelten! dacht' ich, und wandte mich in unbefangener Vertraulichkeit an die beiden Tollhäusler, die mir eben auf dem Verdeck in den Wurf kamen: »Hört, Kinder, ich will hier heut am
beiden Tollhäusler, die mir eben auf dem Verdeck in den Wurf kamen: »Hört, Kinder, ich will hier heut am Lande zur Ader lassen. Ihr beide seht mir beständig so rot und vollblütig aus, daß es euch gleichfalls wohl
Lande zur Ader lassen. Ihr beide seht mir beständig so rot und vollblütig aus, daß es euch gleichfalls wohl gut tun sollte. 'Kommt mit; dann machen wir das gleich in Gesellschaft ab.«
gut tun sollte. 'Kommt mit; dann machen wir das gleich in Gesellschaft ab.« Die beiden Kerle schöpften kein Arges aus dem Vorschlage, der ihnen vielmehr ganz instinktmäßig zusagen
Die beiden Kerle schöpften kein Arges aus dem Vorschlage, der ihnen vielmehr ganz instinktmäßig zusagen mochte. Während sie nun nach meinem Geheiß auf der Hausflur des Barbiers verweilten, trat ich lachend in
mochte. Während sie nun nach meinem Geheiß auf der Hausflur des Barbiers verweilten, trat ich lachend in dessen Zimmer und verkündigte ihm die Gegenwart meiner hirnwütigen Patienten, an denen er nunmehr
dessen Zimmer und verkündigte ihm die Gegenwart meiner hirnwütigen Patienten, an denen er nunmehr seine Kunst erproben möge. Sobald auch nur so viel Frist verlaufen war, als zur Vollendung einiger Aderläs-
seine Kunst erproben möge. Sobald auch nur so viel Frist verlaufen war, als zur Vollendung einiger Aderläs- se erforderlich scheinen mochte, kam ich wieder zum Vorschein, indem ich mich mit einem dazu passenden
se erforderlich scheinen mochte, kam ich wieder zum Vorschein, indem ich mich mit einem dazu passenden Gesichte an den Arm faßte und rief: »Das war fertig; nun, Jakob, ist die Reihe an dir! Herein!« – Der Bursche
Gesichte an den Arm faßte und rief: »Das war fertig; nun, Jakob, ist die Reihe an dir! Herein!« – Der Bursche kam.
kam. Jetzt ging aber die Operation an seinem Arm im Ernste vor sich. Eine große Schüssel füllte sich mit Blut und
Jetzt ging aber die Operation an seinem Arm im Ernste vor sich. Eine große Schüssel füllte sich mit Blut und der Jakob ward immer bleicher um die Nase. Ich gab dem Mann mit dem Schnepper einen verstohlenen
der Jakob ward immer bleicher um die Nase. Ich gab dem Mann mit dem Schnepper einen verstohlenen Wink, daß es nun wohl Zeit sein dürfte, einzuhalten; allein er schüttelte verneinend mit dem Kopf und ließ
Wink, daß es nun wohl Zeit sein dürfte, einzuhalten; allein er schüttelte verneinend mit dem Kopf und ließ auch die zweite Schüssel vollrinnen, bis Jakob endlich besinnungslos umsank und durch einen vorgehalte-
auch die zweite Schüssel vollrinnen, bis Jakob endlich besinnungslos umsank und durch einen vorgehalte- nen Spiritus wieder zu sich gebracht werden mußte. Das nämliche widerfuhr hiernächst auch seinem Zech-
nen Spiritus wieder zu sich gebracht werden mußte. Das nämliche widerfuhr hiernächst auch seinem Zech- kameraden, dem Peter, und beide schwankten dem Schiffe so matt und entkräftet wieder zu, daß sie geführt
kameraden, dem Peter, und beide schwankten dem Schiffe so matt und entkräftet wieder zu, daß sie geführt werden mußten und auch die folgenden vierzehn Tage hindurch auf ihren Füßen nicht stehen konnten. Zur
werden mußten und auch die folgenden vierzehn Tage hindurch auf ihren Füßen nicht stehen konnten. Zur Arbeit blieben sie mir also während dieser Zeit allerdings unbrauchbar, aber auch ihre Tollheit war gänzlich
Arbeit blieben sie mir also während dieser Zeit allerdings unbrauchbar, aber auch ihre Tollheit war gänzlich von ihnen gewichen, und des Barbiers Kunststück hatte sich als vollkommen probat erwiesen.
von ihnen gewichen, und des Barbiers Kunststück hatte sich als vollkommen probat erwiesen. 12. Kapitel, Meersburg, Leipzig 1930
12. Kapitel, Meersburg, Leipzig 1930 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Gottfried Wilhelm Rabener: Satiren
Gottfried Wilhelm Rabener: Satiren Dieser unvermuthete Anblick setzte mich in Erstaunen. Ich machte vor Verwunderung ein paar so große
Dieser unvermuthete Anblick setzte mich in Erstaunen. Ich machte vor Verwunderung ein paar so große Augen, wie ein Würzkrämer in Ritzebüttel, wenn er in seinem Leben zum erstenmale auf die Börse nach
Augen, wie ein Würzkrämer in Ritzebüttel, wenn er in seinem Leben zum erstenmale auf die Börse nach Hamburg kömmt.
Hamburg kömmt. 8. Auflage, Leipzig, im Verlag der Dyckischen Buchhandlung, 1764
8. Auflage, Leipzig, im Verlag der Dyckischen Buchhandlung, 1764 ______________________________________________________________________________________
Freiherr Ferdinand von Rast: Das Leben des Freiherrn Ferdinand von Rast
1802:
Da wir starke» Nordwest-Wind hatten und es sehr stürmisch war, mußte ich wegen Unwohlseins den ganzen
______________________________________________________________________________________
Freiherr Ferdinand von Rast: Das Leben des Freiherrn Ferdinand von Rast
1802:
Da wir starke» Nordwest-Wind hatten und es sehr stürmisch war, mußte ich wegen Unwohlseins den ganzen Tag auf dem Verdeck bleiben. Bei Stade legten wir an, und in Ritzebüttel, nur 10 Minuten von Cuxhaven,
Tag auf dem Verdeck bleiben. Bei Stade legten wir an, und in Ritzebüttel, nur 10 Minuten von Cuxhaven, mußten wir so lange verweilen, bis das Schiff weitersegeln konnte. Endlich Morgens um 6 Uhr langten wir in
mußten wir so lange verweilen, bis das Schiff weitersegeln konnte. Endlich Morgens um 6 Uhr langten wir in Cuxhaven am.
Cuxhaven am. Wir erfuhren dort, daß das Packetboot bereits um 4 Uhr abgesegelt sei, und mußten daher das nächste
Wir erfuhren dort, daß das Packetboot bereits um 4 Uhr abgesegelt sei, und mußten daher das nächste Packetboot abwarten, was uns mehrere Tage zurückhielt. Wir logirten in Ritzebüttel in der „Stadt Hamburg"
Packetboot abwarten, was uns mehrere Tage zurückhielt. Wir logirten in Ritzebüttel in der „Stadt Hamburg" und amüsirten uns in mannigfacher Weise. Nachdem wir unter angenehmen Gesprächen zu Mittag geges-
und amüsirten uns in mannigfacher Weise. Nachdem wir unter angenehmen Gesprächen zu Mittag geges- sen und unserer Lieben in der Heimath gedachten, erfuhren wir Nachmittags im Kaffeehaus Näheres über
sen und unserer Lieben in der Heimath gedachten, erfuhren wir Nachmittags im Kaffeehaus Näheres über die Verhältnisse auf unserm Packetboot und bestellten unsere Plätze. Am Hafen besichtigten wir den
die Verhältnisse auf unserm Packetboot und bestellten unsere Plätze. Am Hafen besichtigten wir den Leuchtthurm, und vernahmen, daß der sehr heftige Wind mehrere Schiffe zum Stranden gebracht hatte. Bis
Leuchtthurm, und vernahmen, daß der sehr heftige Wind mehrere Schiffe zum Stranden gebracht hatte. Bis zum 4. Juli Morgens war es noch stürmisch und conträrer Wind. Nachmittags waren in unserm Wirthshaus
zum 4. Juli Morgens war es noch stürmisch und conträrer Wind. Nachmittags waren in unserm Wirthshaus der Capitain eines verunglückten Schiffes `The Hope´ nebst 5 Matrosen angekommen. Sie hatten ihr Schiff
der Capitain eines verunglückten Schiffes `The Hope´ nebst 5 Matrosen angekommen. Sie hatten ihr Schiff verlassen müssen und sich mit nur sehr wenigen Effecten in einer Schaluppe gerettet.
verlassen müssen und sich mit nur sehr wenigen Effecten in einer Schaluppe gerettet. Die armen Leute hatten viel erdulden müssen und kaum so viel gerettet, um nach England zurückkehren zu
Die armen Leute hatten viel erdulden müssen und kaum so viel gerettet, um nach England zurückkehren zu können. Der Capitain, den wir zum Abendessen eingeladen hatten, erzählte uns dabei die Details des bekla-
können. Der Capitain, den wir zum Abendessen eingeladen hatten, erzählte uns dabei die Details des bekla- genswerthen Ereignisses.
genswerthen Ereignisses. Als andern Tags der Sturm nachließ, beschloß unser Capitain, am nächsten Morgen abzusegeln. Wir ordne-
Als andern Tags der Sturm nachließ, beschloß unser Capitain, am nächsten Morgen abzusegeln. Wir ordne- ten unsere Effecten und am 6. Juli früh Morgens traten wir die Weiterreise an. Das Wetter war zwar schön,
ten unsere Effecten und am 6. Juli früh Morgens traten wir die Weiterreise an. Das Wetter war zwar schön, aber der Wind war keineswegs der günstigste. Als wir bis nahe bei Neuwerk gekommen waren, mußten wir
aber der Wind war keineswegs der günstigste. Als wir bis nahe bei Neuwerk gekommen waren, mußten wir wegen des heftigen und ungünstigen Windes wirklich wieder umkehren und kamen halb 10 Uhr wieder nach
wegen des heftigen und ungünstigen Windes wirklich wieder umkehren und kamen halb 10 Uhr wieder nach Ritzebüttel zurück.
Ritzebüttel zurück. Am 7. Juli fuhr ich Vormittags mit den Herren Friedländer und Lehmann nach dem Strand, um die dort lie-
Am 7. Juli fuhr ich Vormittags mit den Herren Friedländer und Lehmann nach dem Strand, um die dort lie- genden gestrandeten Güter zu sehen, und Nachmittags um 2 Uhr waren wir wieder in Ritzebüttel angelangt.
genden gestrandeten Güter zu sehen, und Nachmittags um 2 Uhr waren wir wieder in Ritzebüttel angelangt. Endlich am 8. Morgens hatte der Wind sich günstiger gewendet, und wir gingen Nachmittags 5 Uhr an Bord
Endlich am 8. Morgens hatte der Wind sich günstiger gewendet, und wir gingen Nachmittags 5 Uhr an Bord unseres Schiffes. Wir waren nur unser sechs Passagiere, darunter auch der am 3. mit seinem Schiffe verun-
unseres Schiffes. Wir waren nur unser sechs Passagiere, darunter auch der am 3. mit seinem Schiffe verun- glückte Capitain.
glückte Capitain. Anfangs war unsere Gesellschaft ziemlich vergnügt, aber nach ein paar Stunden auf der See wurde ich von
Anfangs war unsere Gesellschaft ziemlich vergnügt, aber nach ein paar Stunden auf der See wurde ich von der Seekrankheit auf's hestigste ergriffen und mußte mich niederlegen. Bald erkrankten auch meine Reise-
der Seekrankheit auf's hestigste ergriffen und mußte mich niederlegen. Bald erkrankten auch meine Reise- gefährten; der Wind drehte sich dabei wiederum unserm Schiffe sehr feindselig und bis zur Nacht am 10.
gefährten; der Wind drehte sich dabei wiederum unserm Schiffe sehr feindselig und bis zur Nacht am 10. wurde es so stürmisch, daß wir nicht mehr glaubten, davon zu kommen. Der Sturm warf unser Schiff hin und
wurde es so stürmisch, daß wir nicht mehr glaubten, davon zu kommen. Der Sturm warf unser Schiff hin und her, — und dabei das Elend der Seekrankheit! Genießen konnte ich gar nichts, und schon der Anblick von
her, — und dabei das Elend der Seekrankheit! Genießen konnte ich gar nichts, und schon der Anblick von Speisen erregte mir Ekel. Der Geruch einer Limone belebte mich ein wenig und eine Flasche Rothwein, die
Speisen erregte mir Ekel. Der Geruch einer Limone belebte mich ein wenig und eine Flasche Rothwein, die ich aus Ritzebüttel mitgenommen hatte, diente mir zunächst zur Nahrung. Nachmittags gab mir auch ein
ich aus Ritzebüttel mitgenommen hatte, diente mir zunächst zur Nahrung. Nachmittags gab mir auch ein Glas Porter die Stärkung, deren ich bedurfte.
Glas Porter die Stärkung, deren ich bedurfte. Die Verzögerung, welche wir in Ritzebüttel wegen des widrigen Windes hatten ertragen müssen und das
Die Verzögerung, welche wir in Ritzebüttel wegen des widrigen Windes hatten ertragen müssen und das körperliche Leiden, Beides machte auf mich einen sehr niederbeugenden Eindruck, der bei meiner Jugend
körperliche Leiden, Beides machte auf mich einen sehr niederbeugenden Eindruck, der bei meiner Jugend und durch die Umstände wohl erklärlich war. Die lebhafte Erinnerung an die Erzählung des Capitains von
und durch die Umstände wohl erklärlich war. Die lebhafte Erinnerung an die Erzählung des Capitains von dem verunglückten Schiffe steigerte meinen angstvollen Zustand bis zu Fieberphantasien, in denen mich
dem verunglückten Schiffe steigerte meinen angstvollen Zustand bis zu Fieberphantasien, in denen mich Untergang und Tod fortwährend bedrohten.
Untergang und Tod fortwährend bedrohten. Commissions - Verlag der U. G. Riemann´schen Hofbuchhandlung, Coburg, 1865
Commissions - Verlag der U. G. Riemann´schen Hofbuchhandlung, Coburg, 1865 ______________________________________________________________________________________
Johann Christoph Sachse: Der deutsche Gil Blas
______________________________________________________________________________________
Johann Christoph Sachse: Der deutsche Gil Blas - Zweiter Abschnitt: Reise zu Wasser nach Cuxhaven -
- Zweiter Abschnitt: Reise zu Wasser nach Cuxhaven - Im März des Jahres 1781 kam Befehl, daß die Truppen sich zum Absegeln bereithalten sollten. Von dieser
Im März des Jahres 1781 kam Befehl, daß die Truppen sich zum Absegeln bereithalten sollten. Von dieser Zeit an verging fast nicht ein Tag, an dem nicht eine Exekution vorgefallen wäre.
Zeit an verging fast nicht ein Tag, an dem nicht eine Exekution vorgefallen wäre. In den ersten Tagen des April wurden die Truppen wirklich eingeschifft und gingen nach Ritzebüttel ab,
In den ersten Tagen des April wurden die Truppen wirklich eingeschifft und gingen nach Ritzebüttel ab, wohin ich mich mit meinem jungen Herrn gleichfalls in einem Boote begab, weil derselbe diese Gelegenheit
wohin ich mich mit meinem jungen Herrn gleichfalls in einem Boote begab, weil derselbe diese Gelegenheit benutzen wollte, um eine Reise nach England zu machen.
benutzen wollte, um eine Reise nach England zu machen. Auf den Schiffen befanden sich eine Menge Soldaten, welche mit Gewalt zu der Expedition nach Amerika
Auf den Schiffen befanden sich eine Menge Soldaten, welche mit Gewalt zu der Expedition nach Amerika weggenommen worden oder sonst mit ihrer Lage unzufrieden waren. Da die Schiffe bei Cuxhaven einige
weggenommen worden oder sonst mit ihrer Lage unzufrieden waren. Da die Schiffe bei Cuxhaven einige Tage stilliegen mußten, so gingen daselbst die Herren Offiziere ans Land, um sich's noch wohl sein zu
Tage stilliegen mußten, so gingen daselbst die Herren Offiziere ans Land, um sich's noch wohl sein zu lassen. Dadurch erhielten die Mißvergnügten Gelegenheit, sich miteinander wegen der Desertion zu
lassen. Dadurch erhielten die Mißvergnügten Gelegenheit, sich miteinander wegen der Desertion zu beratschlagen, worüber ein ganzes Bataillon sich vereinigte. Demnach gingen immer je dreißig und dreißig
beratschlagen, worüber ein ganzes Bataillon sich vereinigte. Demnach gingen immer je dreißig und dreißig Mann unter der Androhung vom Schiffe, den wachthabenden Offizier zu erschießen, wofern er den
Mann unter der Androhung vom Schiffe, den wachthabenden Offizier zu erschießen, wofern er den geringsten Lärm machen würde.
geringsten Lärm machen würde. Schon hatten die ersten dreißig Mann einen ziemlichen Vorsprung gewonnen, als der Desertionsversuch der
Schon hatten die ersten dreißig Mann einen ziemlichen Vorsprung gewonnen, als der Desertionsversuch der folgenden von einem andern Schiffe aus bemerkt und deswegen Lärm gemacht wurde, worauf sogleich ein
folgenden von einem andern Schiffe aus bemerkt und deswegen Lärm gemacht wurde, worauf sogleich ein Kommando Kavallerie den Flüchtigen nachsetzen mußte. Diese waren beinahe schon bis Preußisch-Minden
Kommando Kavallerie den Flüchtigen nachsetzen mußte. Diese waren beinahe schon bis Preußisch-Minden gekommen und saßen sorglos und ruhig in einer Schenke, als die Kavallerie sie überraschte und, weil sie
gekommen und saßen sorglos und ruhig in einer Schenke, als die Kavallerie sie überraschte und, weil sie ihre Gewehre abgelegt hatten, gefangennahm.
ihre Gewehre abgelegt hatten, gefangennahm. Während dies geschah, empörte sich die sämtliche Mannschaft aller Schiffe und widersetzte sich dem
Während dies geschah, empörte sich die sämtliche Mannschaft aller Schiffe und widersetzte sich dem Weitersegeln, wodurch der Kommandant von Wangenheim, so glaub ich, hieß er, sich genötigt sah, nach
Weitersegeln, wodurch der Kommandant von Wangenheim, so glaub ich, hieß er, sich genötigt sah, nach Stade zurückschiffen zu lassen.
Stade zurückschiffen zu lassen. ______________________________________________________________________________________
Bernhard Schröder: Erinnerungen 1927 – 1945
Nach sechs Wochen, es war Mitte August (1941), hieß es für mich wieder den Seesack packen: abkomman-
______________________________________________________________________________________
Bernhard Schröder: Erinnerungen 1927 – 1945
Nach sechs Wochen, es war Mitte August (1941), hieß es für mich wieder den Seesack packen: abkomman- diert nach Nordholz, Zentralfunkstelle Deutsche Bucht, Leiter: Kapitän Mannhenke. Ihm unterstanden außer-
diert nach Nordholz, Zentralfunkstelle Deutsche Bucht, Leiter: Kapitän Mannhenke. Ihm unterstanden außer- dem noch die Signalstelle Cuxhaven und die B-Dienststelle Altenwalde.
dem noch die Signalstelle Cuxhaven und die B-Dienststelle Altenwalde. Erst einmal hieß es Abschied nehmen von Borkum. Mit dem Versorgungsboot nach Emden. Dann wieder mit
Erst einmal hieß es Abschied nehmen von Borkum. Mit dem Versorgungsboot nach Emden. Dann wieder mit der Bahn über Oldenburg, Bremen. Wesermünde nach Nordholz. Gleich nebenan lag der Flugplatz Wurster-
der Bahn über Oldenburg, Bremen. Wesermünde nach Nordholz. Gleich nebenan lag der Flugplatz Wurster- heide.
heide. Es war ein warmer Tag. Die Heide machte ihrem Namen alle Ehre. Der Flugplatz, auf dem das „Pik As"-
Es war ein warmer Tag. Die Heide machte ihrem Namen alle Ehre. Der Flugplatz, auf dem das „Pik As"- Jagdgeschwader gelegen hatte, war nach der Umgruppierung in Stille versunken.
Jagdgeschwader gelegen hatte, war nach der Umgruppierung in Stille versunken. Das Haus, in dem die Funkstation untergebracht war, lag an der Straße nach Cuxhaven. Ich meldete mich
Das Haus, in dem die Funkstation untergebracht war, lag an der Straße nach Cuxhaven. Ich meldete mich beim wachhabenden Funkmaat. Einen Laufzettel brauchte ich dieses mal nicht. Es war alles in einem Ge-
beim wachhabenden Funkmaat. Einen Laufzettel brauchte ich dieses mal nicht. Es war alles in einem Ge- bäude. Der Maat übergab die Aufsicht über den Funkraum einem Obergefreiten und ging mit mir in den
bäude. Der Maat übergab die Aufsicht über den Funkraum einem Obergefreiten und ging mit mir in den Schlaftrakt, wo die Funkgasten untergebracht waren. Hier stellte ich meinen Seesack ab.
Schlaftrakt, wo die Funkgasten untergebracht waren. Hier stellte ich meinen Seesack ab. Darauf wurden Spind und Koje inspiziert. Es war alles etwas großzügiger gehalten. Anschließend Wasch-
Darauf wurden Spind und Koje inspiziert. Es war alles etwas großzügiger gehalten. Anschließend Wasch- raum, Essraum, Funkeinrichtung und die Gebäude, in denen die Funkmaaten ihr Domizil hatten, besichtigt.
raum, Essraum, Funkeinrichtung und die Gebäude, in denen die Funkmaaten ihr Domizil hatten, besichtigt. „Morgen früh ist um 7.00 Uhr Appell“, damit blieb ich mir selbst überlassen. Das heißt, allein war ich nicht,
„Morgen früh ist um 7.00 Uhr Appell“, damit blieb ich mir selbst überlassen. Das heißt, allein war ich nicht, denn die Funker der Freiwache wollten doch sehen, was da für ein Neuer gekommen war. Man stand mir mit
denn die Funker der Freiwache wollten doch sehen, was da für ein Neuer gekommen war. Man stand mir mit Rat und Tat zur Seite. Spind einräumen, Bett beziehen, nachdem ich vom Oberfunkmeister das Bettzeug in
Rat und Tat zur Seite. Spind einräumen, Bett beziehen, nachdem ich vom Oberfunkmeister das Bettzeug in Empfang genommen hatte und für den Abend noch meine Fourage überreicht bekam.
Empfang genommen hatte und für den Abend noch meine Fourage überreicht bekam. Der Oberfunkmeister wohnte in einem Haus gegenüber der Funkstelle auf der anderen Straßenseite und
Der Oberfunkmeister wohnte in einem Haus gegenüber der Funkstelle auf der anderen Straßenseite und hatte die Stelle der „Mutter der Kompanie" inne. Er sorgte für alles was die Funkstelle betraf.
hatte die Stelle der „Mutter der Kompanie" inne. Er sorgte für alles was die Funkstelle betraf. Hier wurde ich nun in den allgemeinen Funkdienst integriert. Am anderen Morgen wurde ich als Neuzugang
Hier wurde ich nun in den allgemeinen Funkdienst integriert. Am anderen Morgen wurde ich als Neuzugang dem Stellenpersonal vorgestellt.
dem Stellenpersonal vorgestellt. Jeden Morgen wurde die Fahne vor dem Haus gehisst, des Abends um 18.00 Uhr wieder eingeholt. Diese
Jeden Morgen wurde die Fahne vor dem Haus gehisst, des Abends um 18.00 Uhr wieder eingeholt. Diese Prozedur wurde von zwei Mannschaftsdienstgraden durchgeführt. Ca. zwanzig Mann bevölkerten diese
Prozedur wurde von zwei Mannschaftsdienstgraden durchgeführt. Ca. zwanzig Mann bevölkerten diese Dienststelle, vom Oberfunkmeister bis zum Funkgast. Ich war, wie auf Borkum, auch hier der jüngste.
Dienststelle, vom Oberfunkmeister bis zum Funkgast. Ich war, wie auf Borkum, auch hier der jüngste. Beim Kapitän melden hieß es am anderen Tag. Im „Allerheiligsten" des Funkstellenleiters Deutsche Bucht,
Beim Kapitän melden hieß es am anderen Tag. Im „Allerheiligsten" des Funkstellenleiters Deutsche Bucht, Herrn Kapitän Mannhenke meldete ich mich. „Funkgast Schröder zur Stelle." „Stehen sie bequem."
Herrn Kapitän Mannhenke meldete ich mich. „Funkgast Schröder zur Stelle." „Stehen sie bequem." Darauf stellte er mir Fragen die mein Elternhaus, meinen Beruf betrafen, wie ich auf den Gedanken gekom-
Darauf stellte er mir Fragen die mein Elternhaus, meinen Beruf betrafen, wie ich auf den Gedanken gekom- men war, als Funker zur Marine zu gehen, nach meinem Seesportfunkzeugnis und dergleichen mehr. Dann
men war, als Funker zur Marine zu gehen, nach meinem Seesportfunkzeugnis und dergleichen mehr. Dann entließ er mich.
entließ er mich. Abgesehen von den Aktivitäten in der Deutschen Bucht, waren wir weit vom Kriegsgeschehen entfernt, in
Abgesehen von den Aktivitäten in der Deutschen Bucht, waren wir weit vom Kriegsgeschehen entfernt, in diesem Monat August 1941.
diesem Monat August 1941. Gegenüber der Funkstelle, sie war übrigens mit einem Jägerzaun zur Straßenseite eingefriedigt, lag unter
Gegenüber der Funkstelle, sie war übrigens mit einem Jägerzaun zur Straßenseite eingefriedigt, lag unter anderem ein Privathaus, in dem die Maaten und ein paar Obergefreite wohnten. Man gelangte über eine
anderem ein Privathaus, in dem die Maaten und ein paar Obergefreite wohnten. Man gelangte über eine hölzerne Brücke, die einen Graben überspannte, dorthin. Diese Brücke hatte etwas mit unserem Freizeit-
hölzerne Brücke, die einen Graben überspannte, dorthin. Diese Brücke hatte etwas mit unserem Freizeit- verhalten zu tun. Es war uns zur Gewohnheit geworden des Abends, wenn wir unseren Klön machten, auf
verhalten zu tun. Es war uns zur Gewohnheit geworden des Abends, wenn wir unseren Klön machten, auf dem Geländer zu sitzen und dabei Land und Leute zu beobachten.
dem Geländer zu sitzen und dabei Land und Leute zu beobachten. Jetzt kommt das tolle Stück weswegen ich die Brücke ins Spiel bringe. Um 18.00 Uhr wurde die Fahne ge-
Jetzt kommt das tolle Stück weswegen ich die Brücke ins Spiel bringe. Um 18.00 Uhr wurde die Fahne ge- genüber, vor dem Hauptgebäude, von zwei wachhabenden Funkern eingeholt. Jetzt hätte es sich gehört,
genüber, vor dem Hauptgebäude, von zwei wachhabenden Funkern eingeholt. Jetzt hätte es sich gehört, beim Achtung und Niederholen der Fahne vom Geländer auf dem wir saßen herunterzusteigen, Haltung
beim Achtung und Niederholen der Fahne vom Geländer auf dem wir saßen herunterzusteigen, Haltung anzunehmen und die Fahne zu grüßen (Ehrenbezeugung). Statt dessen ging einer nach dem anderen ins
anzunehmen und die Fahne zu grüßen (Ehrenbezeugung). Statt dessen ging einer nach dem anderen ins Haus. Nachdem die Zeremonie beendet war, saßen plötzlich alle wieder auf ihren alten Plätzen. Da jeder mit
Haus. Nachdem die Zeremonie beendet war, saßen plötzlich alle wieder auf ihren alten Plätzen. Da jeder mit der Zeremonie im Laufe der Woche befasst war, so dachten wir uns nichts weiter dabei. Das ging eine ge-
der Zeremonie im Laufe der Woche befasst war, so dachten wir uns nichts weiter dabei. Das ging eine ge- wisse Zeit so weiter.
wisse Zeit so weiter. Eines Morgens beim Appell hielt uns der Kapitän eine Standpauke.
Eines Morgens beim Appell hielt uns der Kapitän eine Standpauke. „Meine Herren! Also so geht das nicht. Es ist doch nicht zuviel verlangt beim Einholen der Fahne in Achtung
„Meine Herren! Also so geht das nicht. Es ist doch nicht zuviel verlangt beim Einholen der Fahne in Achtung zu stehen, wobei es doch höchstens nur drei Minuten in Anspruch nimmt."
zu stehen, wobei es doch höchstens nur drei Minuten in Anspruch nimmt." Im Stillen hatte er für unser Verhalten sicher Verständnis. Wenn er nicht von einem hundertprozentigen Par-
Im Stillen hatte er für unser Verhalten sicher Verständnis. Wenn er nicht von einem hundertprozentigen Par- teigenossen angesprochen worden wäre, hätte das sicher so weitergehen können.
teigenossen angesprochen worden wäre, hätte das sicher so weitergehen können. Auf der Funkstelle Nordholz wurde ich unter anderem mit dem Verschlüsseln von Funksprüchen vertraut ge-
Auf der Funkstelle Nordholz wurde ich unter anderem mit dem Verschlüsseln von Funksprüchen vertraut ge- macht. Die „Enigma", eine Verschlüsselungsmaschine, galt als nicht zu knacken.
macht. Die „Enigma", eine Verschlüsselungsmaschine, galt als nicht zu knacken. Mein Ft-Hören und -Geben vervollkommnete sich zusehends. Die Q-Gruppen mussten gelernt werden. In
Mein Ft-Hören und -Geben vervollkommnete sich zusehends. Die Q-Gruppen mussten gelernt werden. In der Freiwache machten wir unsere Landgänge durch die Wurster Heide bis zum Ort Spika, wo ein Kino
der Freiwache machten wir unsere Landgänge durch die Wurster Heide bis zum Ort Spika, wo ein Kino betrieben wurde. Ansonsten war nichts los. Schöne Spätsommertage ließen mich die Zeit vergessen. Hin
betrieben wurde. Ansonsten war nichts los. Schöne Spätsommertage ließen mich die Zeit vergessen. Hin und wieder gab es Fliegeralarm.
und wieder gab es Fliegeralarm. Ich war ca. acht Wochen in Nordholz, es war im Oktober, da erhielt ich den Befehl, mich Morgens beim Ka-
Ich war ca. acht Wochen in Nordholz, es war im Oktober, da erhielt ich den Befehl, mich Morgens beim Ka- pitän Mannhenke zu melden. Ich also rein zum Kapitän, die übliche Meldung gemacht: „Stehen sie bequem!"
pitän Mannhenke zu melden. Ich also rein zum Kapitän, die übliche Meldung gemacht: „Stehen sie bequem!" In ganz zivilem Ton sprach er mit mir.
In ganz zivilem Ton sprach er mit mir. „Na, Funkgast Schröder, was halten sie davon, wenn ich sie nach Altenwalde zum B-Dienst versetze."
„Na, Funkgast Schröder, was halten sie davon, wenn ich sie nach Altenwalde zum B-Dienst versetze." „Herr Kapitän," antwortete ich „meiner Meinung nach sollte ich einmal zu den schwimmenden Verbänden
„Herr Kapitän," antwortete ich „meiner Meinung nach sollte ich einmal zu den schwimmenden Verbänden kommen.“
kommen.“ „Ach" sagte er, „mein lieber Junge, der Krieg dauert noch lange, gehe mal erst nach Altenwalde.“ Damit
„Ach" sagte er, „mein lieber Junge, der Krieg dauert noch lange, gehe mal erst nach Altenwalde.“ Damit entließ er mich.
entließ er mich. Am gleichen Tag packte ich erneut meinen Seesack. Ein tägliches Kurierfahrzeug brachte mich sodann zur
Am gleichen Tag packte ich erneut meinen Seesack. Ein tägliches Kurierfahrzeug brachte mich sodann zur B-Dienstfunkstelle, etwas näher an Cuxhaven heran. In der Nähe lag die Küstenfunkstelle „Elbe-Weser-Ra-
B-Dienstfunkstelle, etwas näher an Cuxhaven heran. In der Nähe lag die Küstenfunkstelle „Elbe-Weser-Ra- dio", „D.A.W." (Dora Anton Willi)
dio", „D.A.W." (Dora Anton Willi) Es war insofern keine große Umstellung, weil der Oberfunkmeister der in Nordholz die „Mutter" war, auch auf
Es war insofern keine große Umstellung, weil der Oberfunkmeister der in Nordholz die „Mutter" war, auch auf dieser Funkstelle den Ablauf des militärischen Lebens bestimmte. Die übliche Prozedur des Kennenlernens
dieser Funkstelle den Ablauf des militärischen Lebens bestimmte. Die übliche Prozedur des Kennenlernens und Einweisens wurde mir langsam zur Routine.
und Einweisens wurde mir langsam zur Routine. Auf dieser FT- Stelle konnte ich die „Gebetaste" an den berühmten „Haken" hängen. Hier kam es darauf an,
Auf dieser FT- Stelle konnte ich die „Gebetaste" an den berühmten „Haken" hängen. Hier kam es darauf an, das Gehör noch mehr zu schärfen, galt es doch die englischen Funkwellen zu überwachen.
das Gehör noch mehr zu schärfen, galt es doch die englischen Funkwellen zu überwachen. Die Hälfte der Leute waren alte „Debeg-Funker" (Deutsche Berufsfunker Genossenschaft), also Funker auf
Die Hälfte der Leute waren alte „Debeg-Funker" (Deutsche Berufsfunker Genossenschaft), also Funker auf Schiffen in Friedenszeiten. Sie waren als Obermaaten und Funkmeister bei der Kriegsmarine eingestellt.
Schiffen in Friedenszeiten. Sie waren als Obermaaten und Funkmeister bei der Kriegsmarine eingestellt. Mittlerweile konnte ich mir einen Winkel zu meinem Blitz auf die Ärmel nähen. Ich war jetzt Funkgefreiter. Mit
Mittlerweile konnte ich mir einen Winkel zu meinem Blitz auf die Ärmel nähen. Ich war jetzt Funkgefreiter. Mit den anderen Funkern hatte sich bald ein prima Verhältnis aufgebaut. An Freiwachen gingen wir in die Knei-
den anderen Funkern hatte sich bald ein prima Verhältnis aufgebaut. An Freiwachen gingen wir in die Knei- pen und machten einen auf Alt.
pen und machten einen auf Alt. In Altenwalde gab es zu der Zeit drei Kneipen. „Mutter Elli", „Heinsohn" und „Schröder". Da wurde dann
In Altenwalde gab es zu der Zeit drei Kneipen. „Mutter Elli", „Heinsohn" und „Schröder". Da wurde dann geknobelt, Skat gespielt und erzählt.
geknobelt, Skat gespielt und erzählt. Hinter der Gastwirtschaft „Schröder" gab es eine hohe Sanddüne mit anschließender Heide. Hin und wieder
Hinter der Gastwirtschaft „Schröder" gab es eine hohe Sanddüne mit anschließender Heide. Hin und wieder wurde unsere „Kampfkraft" hier geprüft. Damit die faulen Knochen nicht einrosten hieß es dann „auf den
wurde unsere „Kampfkraft" hier geprüft. Damit die faulen Knochen nicht einrosten hieß es dann „auf den Sandberg, Marsch Marsch". Nach einer halben Stunde hatte der Oberfunkmeister keine Lust mehr und wir
Sandberg, Marsch Marsch". Nach einer halben Stunde hatte der Oberfunkmeister keine Lust mehr und wir kehrten zum Glas Bier in die Wirtschaft ein.
kehrten zum Glas Bier in die Wirtschaft ein. „Da sprach der Scheich zum Emir: trinken wir eins und dann gehen wir, da sprach der Emir zum Scheich:
„Da sprach der Scheich zum Emir: trinken wir eins und dann gehen wir, da sprach der Emir zum Scheich: trinken wir noch eins und dann gehen wir gleich."
trinken wir noch eins und dann gehen wir gleich." Auf diesen Spruch hin hatte ich meinen Namen weg: „Scheich", ein Osnabrücker.
Auf diesen Spruch hin hatte ich meinen Namen weg: „Scheich", ein Osnabrücker. Fortan, wenn vom „Scheich" die Rede war, wusste jeder wer gemeint war. Sowie „Bommel" Pirschek, ein
Fortan, wenn vom „Scheich" die Rede war, wusste jeder wer gemeint war. Sowie „Bommel" Pirschek, ein Berliner, „Dabbelju" Dahnke, ein Hamburger, „Emir" Emst Pfingsten aus Düsseldorf, Walter Dahn aus Dres-
Berliner, „Dabbelju" Dahnke, ein Hamburger, „Emir" Emst Pfingsten aus Düsseldorf, Walter Dahn aus Dres- den. Wir waren schon ein toller Verein „Stenze und Tätowierer", „Jede Menge Barcelona" und andere Sprü-
den. Wir waren schon ein toller Verein „Stenze und Tätowierer", „Jede Menge Barcelona" und andere Sprü- che wurden gedroschen.
che wurden gedroschen. Es war mittlerweile Dezember, der tägliche Dienstablauf war mir zur Routine geworden.
Es war mittlerweile Dezember, der tägliche Dienstablauf war mir zur Routine geworden. Auf dem Adcock-Peiler, dieser stand etwa 150 Meter von der Funkbaracke entfernt im freien Feld, hatte ich
Auf dem Adcock-Peiler, dieser stand etwa 150 Meter von der Funkbaracke entfernt im freien Feld, hatte ich meine ersten Wachen mit einem FT-Maat geschoben. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich ein ausge-
meine ersten Wachen mit einem FT-Maat geschoben. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich ein ausge- zeichnetes Gehör hatte. Es war gar nicht so einfach auf der Kurzwelle, wo mehrere Sender dicht nebenein-
zeichnetes Gehör hatte. Es war gar nicht so einfach auf der Kurzwelle, wo mehrere Sender dicht nebenein- ander lagen, den zu erfassenden herauszufiltern und die Morsezeichen zu Papier zu bringen.
ander lagen, den zu erfassenden herauszufiltern und die Morsezeichen zu Papier zu bringen. Der Winter 1941/42 war ein geradezu extrem kalter und schneereicher. Die Funkstation, die etwa 200 Meter
Der Winter 1941/42 war ein geradezu extrem kalter und schneereicher. Die Funkstation, die etwa 200 Meter von der Straße nach Cuxhaven entfernt in einer Senke lag, war eines Morgens bis unterhalb der Dachtraufe
von der Straße nach Cuxhaven entfernt in einer Senke lag, war eines Morgens bis unterhalb der Dachtraufe im Schnee versunken.
im Schnee versunken. „Alle Mann raus zum Schneeschieben!"
„Alle Mann raus zum Schneeschieben!" Erst einmal bis zur Straße freimachen, damit der Personenverkehr gewährleistet wurde. Links und rechts des
Erst einmal bis zur Straße freimachen, damit der Personenverkehr gewährleistet wurde. Links und rechts des Weges türmten sich die Wehen zwei Meter hoch. Warm angezogen war es ein Spaß uns richtig loszuarbei-
Weges türmten sich die Wehen zwei Meter hoch. Warm angezogen war es ein Spaß uns richtig loszuarbei- ten. Unser Chef, der Kapitän, kam dann später und war des Lobes voll.
ten. Unser Chef, der Kapitän, kam dann später und war des Lobes voll. Zum Weihnachtsfest wurden Leute gesucht, die freiwillig Funkwache übernahmen. Jetzt und auch später bin
Zum Weihnachtsfest wurden Leute gesucht, die freiwillig Funkwache übernahmen. Jetzt und auch später bin ich am Heiligen Abend immer Funkwache gegangen. Dafür hatte ich dann am Sylvester Freiwache.
ich am Heiligen Abend immer Funkwache gegangen. Dafür hatte ich dann am Sylvester Freiwache. Die Wege von der Wohnbaracke zur Straße, zur Funkbaracke und zum Peiler mussten immer frei gehalten
Die Wege von der Wohnbaracke zur Straße, zur Funkbaracke und zum Peiler mussten immer frei gehalten werden. Die Landschaft sah aus als seien Maulwürfe am Werk gewesen.
werden. Die Landschaft sah aus als seien Maulwürfe am Werk gewesen. Eine herausragende Episode war der Sylvesterabend. Ernst, Walter,
Eine herausragende Episode war der Sylvesterabend. Ernst, Walter, Willi und ich waren bei Heinsohn, der bereits erwähnten Gastwirtschaft,
Willi und ich waren bei Heinsohn, der bereits erwähnten Gastwirtschaft, eingekehrt. Wir wollten einen draufmachen. Bei Grog und Bier fing der
eingekehrt. Wir wollten einen draufmachen. Bei Grog und Bier fing der Abend gut an. Unterhaltung gab es genug. Die Mädchen aus dem Dorf
Abend gut an. Unterhaltung gab es genug. Die Mädchen aus dem Dorf und Umgebung waren auch vertreten. Soldaten einer Artillerieabtei-
und Umgebung waren auch vertreten. Soldaten einer Artillerieabtei- lung, die vorübergehend in Nordholz lagen, konnten es nicht lassen, uns
lung, die vorübergehend in Nordholz lagen, konnten es nicht lassen, uns zu hänseln. Ein Feldwebel tat sich besonders hervor.
zu hänseln. Ein Feldwebel tat sich besonders hervor. Im Jahr 1941/42 konnte man noch gut und gerne „einen in die Hacken"
Im Jahr 1941/42 konnte man noch gut und gerne „einen in die Hacken" bekommen, will sagen; es gab noch genügend Alkohol um sich zu
bekommen, will sagen; es gab noch genügend Alkohol um sich zu betrinken.
betrinken. Jedenfalls in seinem Suff nannte er uns „nachgemachte Krieger", „Bubikragenträger" und so weiter. Wir ver-
Jedenfalls in seinem Suff nannte er uns „nachgemachte Krieger", „Bubikragenträger" und so weiter. Wir ver- wahrten uns gegen diese Ausdrücke. Da wurde der Mensch noch erboster. Die anwesenden Artilleristen
wahrten uns gegen diese Ausdrücke. Da wurde der Mensch noch erboster. Die anwesenden Artilleristen wollten ihn beruhigen, er aber zog eine Pistole und fuchtelte damit in der Gegend herum.
wollten ihn beruhigen, er aber zog eine Pistole und fuchtelte damit in der Gegend herum. Wir verließen auf die Schnelle das Lokal und begaben uns zur Funkstelle. Unser Stellenleiter, ein Ober-
Wir verließen auf die Schnelle das Lokal und begaben uns zur Funkstelle. Unser Stellenleiter, ein Ober- fähnrich, als er uns sah: „Na, habt ihr schon genug, dass ihr schon wieder hier seid?"
fähnrich, als er uns sah: „Na, habt ihr schon genug, dass ihr schon wieder hier seid?" Es begann das Erzählen unseres Erlebnisses.
Es begann das Erzählen unseres Erlebnisses. „Das geht ja nun nicht, wartet einen Moment, ich komme mit und werde mir den Herren mal vorknöpfen."
„Das geht ja nun nicht, wartet einen Moment, ich komme mit und werde mir den Herren mal vorknöpfen." In der Gastwirtschaft Heinsohn ging es hoch her als wir mit dem Stellenleiter eintraten. Augenblicklich kehrte
In der Gastwirtschaft Heinsohn ging es hoch her als wir mit dem Stellenleiter eintraten. Augenblicklich kehrte Ruhe ein. Der Feldwebel musste seine Pistole unserem Vorgesetzten aushändigen. Es gab noch ein hin und
Ruhe ein. Der Feldwebel musste seine Pistole unserem Vorgesetzten aushändigen. Es gab noch ein hin und her von Fragen und Antworten, dann schloss unser Stellenleiter mit den Worten: „Sie können sich ihre Pisto-
her von Fragen und Antworten, dann schloss unser Stellenleiter mit den Worten: „Sie können sich ihre Pisto- le beim Kapitän Mannhenke abholen, wenn sie wieder nüchtern sind."
le beim Kapitän Mannhenke abholen, wenn sie wieder nüchtern sind." Sylvester haben wir dann in der Station weitergefeiert. Von unserer Marketenderware hatten wir noch Vorrä-
Sylvester haben wir dann in der Station weitergefeiert. Von unserer Marketenderware hatten wir noch Vorrä- te. Zu den Toilettenartikeln gab es auch immer eine Flasche Bols Likör. Damit begossen wir den Übergang
te. Zu den Toilettenartikeln gab es auch immer eine Flasche Bols Likör. Damit begossen wir den Übergang ins Jahr 1942.
ins Jahr 1942. Mein Kumpel Emst fragte am darauf folgenden Sonntag, wir hatten Freiwache: „Gehst du mit nach Cuxhaven
Mein Kumpel Emst fragte am darauf folgenden Sonntag, wir hatten Freiwache: „Gehst du mit nach Cuxhaven ins Kino?" Ich wollte.
ins Kino?" Ich wollte. Zuerst schauten wir uns die Elbe bei der „Alten Liebe" an. So große Eisblöcke hatte ich bis dahin noch nicht
Zuerst schauten wir uns die Elbe bei der „Alten Liebe" an. So große Eisblöcke hatte ich bis dahin noch nicht zu Gesicht bekommen. Der ganze Strom war dicht. Es knackte und knarrte wenn sich die Eisschollen über-
zu Gesicht bekommen. Der ganze Strom war dicht. Es knackte und knarrte wenn sich die Eisschollen über- einander schoben. Um das Schauspiel noch länger zu genießen begaben wir uns ins „Pik As", eine Tanzbar,
einander schoben. Um das Schauspiel noch länger zu genießen begaben wir uns ins „Pik As", eine Tanzbar, zu erreichen über eine Brücke, die vom alten Deich in das zweite Obergeschoss eines Hauses führte. Hier
zu erreichen über eine Brücke, die vom alten Deich in das zweite Obergeschoss eines Hauses führte. Hier spielte eine Tanzkapelle. Das Tanzen war allerdings verboten. Nachdem wir ein paar Bier getrunken hatten
spielte eine Tanzkapelle. Das Tanzen war allerdings verboten. Nachdem wir ein paar Bier getrunken hatten sind wir dann ins Kino gegangen.
sind wir dann ins Kino gegangen. Die nächste Zeit war mit Wachegehen (am Empfänger) ausgefüllt. Für mich war die „Mittelwache", einfach
Die nächste Zeit war mit Wachegehen (am Empfänger) ausgefüllt. Für mich war die „Mittelwache", einfach ausgedrückt, unangenehm. Sie betraf die Zeit von Nachts um 01:00 bis 07:00 Uhr Morgens. Die Augen und
ausgedrückt, unangenehm. Sie betraf die Zeit von Nachts um 01:00 bis 07:00 Uhr Morgens. Die Augen und Ohren mussten offen bleiben und das fiel schwer. So lange die Englander Funkverkehr hatten war man an-
Ohren mussten offen bleiben und das fiel schwer. So lange die Englander Funkverkehr hatten war man an- gespannt, sobald längere Pausen eintraten fielen einem die Augen zu. Eine lange Zeit, die zwischen 04:00
gespannt, sobald längere Pausen eintraten fielen einem die Augen zu. Eine lange Zeit, die zwischen 04:00 und 06:00 Uhr.
und 06:00 Uhr. Damit keiner einschlief ging der wachhabende Funkmaat von Zeit zu Zeit durch den Funkraum.
Damit keiner einschlief ging der wachhabende Funkmaat von Zeit zu Zeit durch den Funkraum. Wenn Schnellsendungen auf dem Magnetophonband aufgenommen waren, wurden diese am nächsten Mor-
Wenn Schnellsendungen auf dem Magnetophonband aufgenommen waren, wurden diese am nächsten Mor- gen ins Reine übertragen. Da konnte man das Abhörtempo dann selbst bestimmen.
gen ins Reine übertragen. Da konnte man das Abhörtempo dann selbst bestimmen. Auf der MPS (Marine Peil Stelle) Altenwalde waren in diesem Frühjahr 1942 keine außergewöhnlichen Er-
Auf der MPS (Marine Peil Stelle) Altenwalde waren in diesem Frühjahr 1942 keine außergewöhnlichen Er- eignisse zu melden.
eignisse zu melden. Meinen ersten Heimaturlaub hatte ich auch schon hinter mir. Mein Bruder Georg war zur motorisierten Infan-
Meinen ersten Heimaturlaub hatte ich auch schon hinter mir. Mein Bruder Georg war zur motorisierten Infan- terie eingezogen worden. Ferdinand war mit den Veterinären von Danzig nach Norwegen verlegt worden.
terie eingezogen worden. Ferdinand war mit den Veterinären von Danzig nach Norwegen verlegt worden. Franz war noch auf dem OKD beschäftigt und hatte hier bei einem Luftangriff eine Verletzung erlitten, von
Franz war noch auf dem OKD beschäftigt und hatte hier bei einem Luftangriff eine Verletzung erlitten, von der er ein steifes Bein nachbehielt.
der er ein steifes Bein nachbehielt. Der Laden zu Hause lief weiter, dank der Unverwüstlichkeit meiner Eltern. Mein Vater hatte einen Anhänger
Der Laden zu Hause lief weiter, dank der Unverwüstlichkeit meiner Eltern. Mein Vater hatte einen Anhänger für das Fahrrad gebaut, mit dem er alle noch verfügbaren Produkte für das tägliche Leben herankarrte.
für das Fahrrad gebaut, mit dem er alle noch verfügbaren Produkte für das tägliche Leben herankarrte. Mein Schwager, der bei den Fokke-Wulf-Werken in Bremen beschäftigt war, hatte eine Einberufung zur Flak
Mein Schwager, der bei den Fokke-Wulf-Werken in Bremen beschäftigt war, hatte eine Einberufung zur Flak bekommen. Seine Frau Agnes war nach einem Bombenangriff mit Sack und Pack und ihren Kindern wieder
bekommen. Seine Frau Agnes war nach einem Bombenangriff mit Sack und Pack und ihren Kindern wieder ins Elternhaus nach Eversburg gezogen. Sie unterstützte Mutter und Hanna im Haushalt.
ins Elternhaus nach Eversburg gezogen. Sie unterstützte Mutter und Hanna im Haushalt. Im April 1942 bekam ich Besuch von meinem Bruder Ferdinand auf der MPS. Wir hatten uns seit Weihnach-
Im April 1942 bekam ich Besuch von meinem Bruder Ferdinand auf der MPS. Wir hatten uns seit Weihnach- ten 1939 nicht mehr gesehen, für ein paar Stunden waren wir zusammen, ich hatte zum Glück gerade Frei-
ten 1939 nicht mehr gesehen, für ein paar Stunden waren wir zusammen, ich hatte zum Glück gerade Frei- wache.
wache. Er erzählte seine Erlebnisse bei der Überfährt von Dänemark nach Norwegen. Englische U-Boote hatten den
Er erzählte seine Erlebnisse bei der Überfährt von Dänemark nach Norwegen. Englische U-Boote hatten den Konvoi angegriffen und einige Dampfer versenkt. Er selbst war unversehrt.
Konvoi angegriffen und einige Dampfer versenkt. Er selbst war unversehrt. Neuigkeiten gab es genug in der Familie. Die Zeit verrann im Fluge. Ich habe ihn dann zum Bahnhof ge-
Neuigkeiten gab es genug in der Familie. Die Zeit verrann im Fluge. Ich habe ihn dann zum Bahnhof ge- bracht. Wiedergesehen haben wir uns erst nach dem Kriege.
bracht. Wiedergesehen haben wir uns erst nach dem Kriege. Eines Tages im April oder Mai 1942 machte die halbe Mannschaft einen Trip nach Hamburg. Einmal die
Eines Tages im April oder Mai 1942 machte die halbe Mannschaft einen Trip nach Hamburg. Einmal die Reeperbahn rauf und runter. „Jetzt gehen wir Hippodrom" sagte der begleitende Funkmeister. Für mich alles
Reeperbahn rauf und runter. „Jetzt gehen wir Hippodrom" sagte der begleitende Funkmeister. Für mich alles wieder neue Aspekte. Der Eingang der Herbertstraße wurde natürlich auch besichtigt. Es wurde dort alles
wieder neue Aspekte. Der Eingang der Herbertstraße wurde natürlich auch besichtigt. Es wurde dort alles auf kleiner Flamme gekocht. Hamburg hatte zu der Zeit noch keinen Luftangriff im großen Stil erlebt.
auf kleiner Flamme gekocht. Hamburg hatte zu der Zeit noch keinen Luftangriff im großen Stil erlebt. Im Alsterpavillon spielte Bernhard Été mit seiner Band auf. Als Junge aus der Provinz liefen mir Augen und
Im Alsterpavillon spielte Bernhard Été mit seiner Band auf. Als Junge aus der Provinz liefen mir Augen und Ohren über.
Ohren über. Einmal bekamen wir in Altenwalde das „Fronttheater" zu sehen. Eine von mehreren Truppen, die den Solda-
Einmal bekamen wir in Altenwalde das „Fronttheater" zu sehen. Eine von mehreren Truppen, die den Solda- ten an allen Fronten das Leben „verschönern" sollten. Künstler jeglicher Couleur waren vertreten. Artisten,
ten an allen Fronten das Leben „verschönern" sollten. Künstler jeglicher Couleur waren vertreten. Artisten, Jongleure, Musiker und so weiter. Will Glahé mit seinen Rhythmikern machte die Musik.
Jongleure, Musiker und so weiter. Will Glahé mit seinen Rhythmikern machte die Musik. Es war im Juni, etwa um den 10. herum, ich war in meiner Freiwache mit einem Kumpel nach Cuxhaven ge-
Es war im Juni, etwa um den 10. herum, ich war in meiner Freiwache mit einem Kumpel nach Cuxhaven ge- fahren. Es war ein schöner Sonntag. Einmal bis zur .Alten Liebe", dann ins „Pik As", wo eine Kapelle spielte.
fahren. Es war ein schöner Sonntag. Einmal bis zur .Alten Liebe", dann ins „Pik As", wo eine Kapelle spielte. Für einen Kinobesuch war es zu spät.
Für einen Kinobesuch war es zu spät. Auf dem Heimweg zur Funkstelle trafen wir Funker, die auch in der Stadt, aber dort im Kino gewesen waren.
Auf dem Heimweg zur Funkstelle trafen wir Funker, die auch in der Stadt, aber dort im Kino gewesen waren. „Du, Scheich," sagte einer, „dein Name ist während der Vorstellung, bei einer Unterbrechung, genannt wor-
„Du, Scheich," sagte einer, „dein Name ist während der Vorstellung, bei einer Unterbrechung, genannt wor- den, du solltest sofort zur Funkstelle zurückkommen.“ Was das wohl zu bedeuten hatte?
den, du solltest sofort zur Funkstelle zurückkommen.“ Was das wohl zu bedeuten hatte? In der MPS angekommen meldete ich mich sogleich beim wachhabenden Maat: „Melde dich mal sofort beim
In der MPS angekommen meldete ich mich sogleich beim wachhabenden Maat: „Melde dich mal sofort beim Chef.”
Chef.” Ich rein: „Funkgefreiter Schröder meldet sich zur Stelle."
Ich rein: „Funkgefreiter Schröder meldet sich zur Stelle." „Sie packen ihren Seesack, Reisepapiere sind schon fertig. Morgen früh fahren sie und melden sich beim
„Sie packen ihren Seesack, Reisepapiere sind schon fertig. Morgen früh fahren sie und melden sich beim OKM (Oberkommando der Marine) am Tirpitzufer in Berlin."
OKM (Oberkommando der Marine) am Tirpitzufer in Berlin." Er wünschte mir noch alles Gute und sagte mir dann, dass ich zu einem Sonderkommando in Spanien ver-
Er wünschte mir noch alles Gute und sagte mir dann, dass ich zu einem Sonderkommando in Spanien ver- setzt wurde.
setzt wurde. Von diesem „Verein" trennte ich mich nicht so gerne. Was wollte man machen, es war Krieg. Ich verabschie-
Von diesem „Verein" trennte ich mich nicht so gerne. Was wollte man machen, es war Krieg. Ich verabschie- dete mich am anderen Morgen von meinen Kumpels, schulterte meinen Seesack und los ging es. - Auf ein
dete mich am anderen Morgen von meinen Kumpels, schulterte meinen Seesack und los ging es. - Auf ein Neues.
Neues. Mit dem Bus nach Cuxhaven Bahnhof, schon war ich wieder auf der Schiene, Richtung Hamburg. Zu der Zeit
Mit dem Bus nach Cuxhaven Bahnhof, schon war ich wieder auf der Schiene, Richtung Hamburg. Zu der Zeit waren viele Soldaten unterwegs. In jedem Zug war Feldgendarmerie im Einsatz. Jeder Fahrgast musste sich
waren viele Soldaten unterwegs. In jedem Zug war Feldgendarmerie im Einsatz. Jeder Fahrgast musste sich exakt ausweisen können. Eine Doppelstreife ließ sich die Fahrausweise zeigen.
exakt ausweisen können. Eine Doppelstreife ließ sich die Fahrausweise zeigen. Mit dem Stahlhelm auf dem Kopf und Pistole am Gürtel, dazu noch ein silbrig glänzendes Schild an einer
Mit dem Stahlhelm auf dem Kopf und Pistole am Gürtel, dazu noch ein silbrig glänzendes Schild an einer Kette um den Hals gehängt, machten sie einen martialischen Eindruck (im Volksmund auch „Kettenhunde"
Kette um den Hals gehängt, machten sie einen martialischen Eindruck (im Volksmund auch „Kettenhunde" genannt).
genannt). In Hamburg Hauptbahnhof musste ich umsteigen in einen D-Zug nach Berlin. Der Juni hatte schöne Tage
In Hamburg Hauptbahnhof musste ich umsteigen in einen D-Zug nach Berlin. Der Juni hatte schöne Tage und die mecklenburgische Landschaft prangte im Frühlingsgrün. Vom Zug aus konnte man schon die großen
und die mecklenburgische Landschaft prangte im Frühlingsgrün. Vom Zug aus konnte man schon die großen Funkmasten in Nauen sehen. Jetzt war Berlin nicht mehr weit. Spandau, Anhalter Bahnhof, Endstation, alles
Funkmasten in Nauen sehen. Jetzt war Berlin nicht mehr weit. Spandau, Anhalter Bahnhof, Endstation, alles aussteigen. - Ich war in der Reichshauptstadt.
aussteigen. - Ich war in der Reichshauptstadt. Quelle
Quelle ______________________________________________________________________________________
Willy Seitel: Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
______________________________________________________________________________________
Willy Seitel: Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen - Licht in der Finsternis -
- Licht in der Finsternis - Im Jahr des Unheils 1915, im Frühling, erfuhr man, ein Torpedobootzerstörer sei zwischen Helgoland und
Im Jahr des Unheils 1915, im Frühling, erfuhr man, ein Torpedobootzerstörer sei zwischen Helgoland und Cuxhaven auf eine Treibmine aufgefahren. Die Hälfte der Besatzung fiel der Explosion selbst zum Opfer, die
Cuxhaven auf eine Treibmine aufgefahren. Die Hälfte der Besatzung fiel der Explosion selbst zum Opfer, die andere Hälfte wurde zum Teil noch schwimmend geborgen, und zwar durch ein zufällig vorbeikreuzendes
andere Hälfte wurde zum Teil noch schwimmend geborgen, und zwar durch ein zufällig vorbeikreuzendes Schulschiff.
Schulschiff. Unter diesen in letzter Minute Geretteten befand sich auch ein gewisser Leichtmatrose namens Max Ziehlke,
Unter diesen in letzter Minute Geretteten befand sich auch ein gewisser Leichtmatrose namens Max Ziehlke, der, kaum ins Trockene gebracht, einer tiefen Bewußtlosigkeit verfiel. Diese vollständige Apathie und
der, kaum ins Trockene gebracht, einer tiefen Bewußtlosigkeit verfiel. Diese vollständige Apathie und Schockwirkung war so kräftig, daß er noch im Lazarett in Berlin eine Woche nachher in tiefem Schlafe lag.
Schockwirkung war so kräftig, daß er noch im Lazarett in Berlin eine Woche nachher in tiefem Schlafe lag. Man hatte seine Eltern noch nicht verständigt, da deren Besuch zunächst völlig zwecklos schien.
Man hatte seine Eltern noch nicht verständigt, da deren Besuch zunächst völlig zwecklos schien. ______________________________________________________________________________________
Seite 4
______________________________________________________________________________________
Seite 4
 Schiffsvolk nämlich, durchaus dem Suff ergeben, wollte an der Gelegenheit nichts versäumen, den Weinfäs-
Schiffsvolk nämlich, durchaus dem Suff ergeben, wollte an der Gelegenheit nichts versäumen, den Weinfäs- sern, die einen Teil unsrer Ladung ausmachten, aufs fleißigste zuzusprechen. Als ich dem zu wehren
sern, die einen Teil unsrer Ladung ausmachten, aufs fleißigste zuzusprechen. Als ich dem zu wehren gedachte, rottierten sich die Kerle zusammen, schlugen mit Gewalt die Luken auf, zapften die Oxhöfte an
gedachte, rottierten sich die Kerle zusammen, schlugen mit Gewalt die Luken auf, zapften die Oxhöfte an und ließen den Wein stromweise in ihre Wassereimer und Hüte rinnen. In wenig Stunden hatte sich alles toll
und ließen den Wein stromweise in ihre Wassereimer und Hüte rinnen. In wenig Stunden hatte sich alles toll und voll gesoffen. Von nun an hatte es aber auch mit allem Kommando ein Ende. Die Vollzapfe waren wie
und voll gesoffen. Von nun an hatte es aber auch mit allem Kommando ein Ende. Die Vollzapfe waren wie wütend und ich und der Steuermann unsers Lebens unter ihnen nicht mehr sicher.
wütend und ich und der Steuermann unsers Lebens unter ihnen nicht mehr sicher. Und so ging es fortan einen Tag wie den andern. Wir beide mochten zusehen, wie wir konnten, damit das
Und so ging es fortan einen Tag wie den andern. Wir beide mochten zusehen, wie wir konnten, damit das Schiff wenigstens einigermaßen seinen Kurs hielt. War es auch geradezu nicht Rebellion zu nennen, so
Schiff wenigstens einigermaßen seinen Kurs hielt. War es auch geradezu nicht Rebellion zu nennen, so blieb es doch ein wüstes Tollmannsleben, wobei weder gute noch böse Worte anschlugen, und wir paar
blieb es doch ein wüstes Tollmannsleben, wobei weder gute noch böse Worte anschlugen, und wir paar Vernünftige die größte Gefahr und Not vor Augen sahen, so oft Segel sollten beigesetzt oder eingenommen
Vernünftige die größte Gefahr und Not vor Augen sahen, so oft Segel sollten beigesetzt oder eingenommen werden. Endlich half Gott wiewohl unter Angst und Schrecken, daß wir bei Kuxhaven vor der Mündung der
werden. Endlich half Gott wiewohl unter Angst und Schrecken, daß wir bei Kuxhaven vor der Mündung der Elbe anlangten. Gerade hier aber konnte ich mich auch mit diesen Menschen unmöglich weiter wagen, da
Elbe anlangten. Gerade hier aber konnte ich mich auch mit diesen Menschen unmöglich weiter wagen, da man in den Eugen des Stromes immerfort zu lavieren hatte, oder die Anker fallen lassen mußte. Ich be-
man in den Eugen des Stromes immerfort zu lavieren hatte, oder die Anker fallen lassen mußte. Ich be- schloß also, an Land zu gehen und acht oder zehn tüchtige Menschen anzunehmen, die mir nach Hamburg
schloß also, an Land zu gehen und acht oder zehn tüchtige Menschen anzunehmen, die mir nach Hamburg hinauf helfen sollten.
hinauf helfen sollten. Zufällig trat ich in dem Örtchen zu einem Barbier ein, um mich unter sein Schermesser zu liefern. Ich ward
Zufällig trat ich in dem Örtchen zu einem Barbier ein, um mich unter sein Schermesser zu liefern. Ich ward aber nicht bloß geschoren, sondern auch daneben so kunstmäßig ausgefragt, daß mir die Not und das
aber nicht bloß geschoren, sondern auch daneben so kunstmäßig ausgefragt, daß mir die Not und das Elend, worin ich mit meinem gar nicht mehr zu ernüchternden Schiffsvolke steckte, gar bald in lauter Klage
Elend, worin ich mit meinem gar nicht mehr zu ernüchternden Schiffsvolke steckte, gar bald in lauter Klage über die Lippen trat. Vor allem erwähnte ich zweier Kerle, die sich im eigentlichen Sinne rasend gesof-fen zu
über die Lippen trat. Vor allem erwähnte ich zweier Kerle, die sich im eigentlichen Sinne rasend gesof-fen zu haben schienen und ganz wie von Sinn und Verstand gekommen wären. – »Nun, der Verstand wäre ihnen
haben schienen und ganz wie von Sinn und Verstand gekommen wären. – »Nun, der Verstand wäre ihnen wohl leicht wieder einzutrichtern«, versetzte der Barbier mit einer schlauen Miene, »wenn ihnen nur zuvor
wohl leicht wieder einzutrichtern«, versetzte der Barbier mit einer schlauen Miene, »wenn ihnen nur zuvor der Unverstand und die tollen Affekten hinlänglich abgezapft worden.« – Er meinte nämlich (wie er sich
der Unverstand und die tollen Affekten hinlänglich abgezapft worden.« – Er meinte nämlich (wie er sich darüber auf mein Befragen näher erklärte), ein tüchtiger Aderlaß bis zur Ohnmacht sollte diese bestialische
darüber auf mein Befragen näher erklärte), ein tüchtiger Aderlaß bis zur Ohnmacht sollte diese bestialische Tollheit, wenn sie bloß im Suff ihren Grund hatte, schon zur Ordnung bringen.
Tollheit, wenn sie bloß im Suff ihren Grund hatte, schon zur Ordnung bringen. Zwar nehm ich von diesem medizinischen Gutachten keine weitere Notiz; doch als ich am andern Morgen
Zwar nehm ich von diesem medizinischen Gutachten keine weitere Notiz; doch als ich am andern Morgen wieder an Land wollte, um die gedungenen Leute an Bord zu nehmen, fiel mir der Barbier und sein Heilmittel
wieder an Land wollte, um die gedungenen Leute an Bord zu nehmen, fiel mir der Barbier und sein Heilmittel wieder ein. Mag es den Versuch gelten! dacht' ich, und wandte mich in unbefangener Vertraulichkeit an die
wieder ein. Mag es den Versuch gelten! dacht' ich, und wandte mich in unbefangener Vertraulichkeit an die beiden Tollhäusler, die mir eben auf dem Verdeck in den Wurf kamen: »Hört, Kinder, ich will hier heut am
beiden Tollhäusler, die mir eben auf dem Verdeck in den Wurf kamen: »Hört, Kinder, ich will hier heut am Lande zur Ader lassen. Ihr beide seht mir beständig so rot und vollblütig aus, daß es euch gleichfalls wohl
Lande zur Ader lassen. Ihr beide seht mir beständig so rot und vollblütig aus, daß es euch gleichfalls wohl gut tun sollte. 'Kommt mit; dann machen wir das gleich in Gesellschaft ab.«
gut tun sollte. 'Kommt mit; dann machen wir das gleich in Gesellschaft ab.« Die beiden Kerle schöpften kein Arges aus dem Vorschlage, der ihnen vielmehr ganz instinktmäßig zusagen
Die beiden Kerle schöpften kein Arges aus dem Vorschlage, der ihnen vielmehr ganz instinktmäßig zusagen mochte. Während sie nun nach meinem Geheiß auf der Hausflur des Barbiers verweilten, trat ich lachend in
mochte. Während sie nun nach meinem Geheiß auf der Hausflur des Barbiers verweilten, trat ich lachend in dessen Zimmer und verkündigte ihm die Gegenwart meiner hirnwütigen Patienten, an denen er nunmehr
dessen Zimmer und verkündigte ihm die Gegenwart meiner hirnwütigen Patienten, an denen er nunmehr seine Kunst erproben möge. Sobald auch nur so viel Frist verlaufen war, als zur Vollendung einiger Aderläs-
seine Kunst erproben möge. Sobald auch nur so viel Frist verlaufen war, als zur Vollendung einiger Aderläs- se erforderlich scheinen mochte, kam ich wieder zum Vorschein, indem ich mich mit einem dazu passenden
se erforderlich scheinen mochte, kam ich wieder zum Vorschein, indem ich mich mit einem dazu passenden Gesichte an den Arm faßte und rief: »Das war fertig; nun, Jakob, ist die Reihe an dir! Herein!« – Der Bursche
Gesichte an den Arm faßte und rief: »Das war fertig; nun, Jakob, ist die Reihe an dir! Herein!« – Der Bursche kam.
kam. Jetzt ging aber die Operation an seinem Arm im Ernste vor sich. Eine große Schüssel füllte sich mit Blut und
Jetzt ging aber die Operation an seinem Arm im Ernste vor sich. Eine große Schüssel füllte sich mit Blut und der Jakob ward immer bleicher um die Nase. Ich gab dem Mann mit dem Schnepper einen verstohlenen
der Jakob ward immer bleicher um die Nase. Ich gab dem Mann mit dem Schnepper einen verstohlenen Wink, daß es nun wohl Zeit sein dürfte, einzuhalten; allein er schüttelte verneinend mit dem Kopf und ließ
Wink, daß es nun wohl Zeit sein dürfte, einzuhalten; allein er schüttelte verneinend mit dem Kopf und ließ auch die zweite Schüssel vollrinnen, bis Jakob endlich besinnungslos umsank und durch einen vorgehalte-
auch die zweite Schüssel vollrinnen, bis Jakob endlich besinnungslos umsank und durch einen vorgehalte- nen Spiritus wieder zu sich gebracht werden mußte. Das nämliche widerfuhr hiernächst auch seinem Zech-
nen Spiritus wieder zu sich gebracht werden mußte. Das nämliche widerfuhr hiernächst auch seinem Zech- kameraden, dem Peter, und beide schwankten dem Schiffe so matt und entkräftet wieder zu, daß sie geführt
kameraden, dem Peter, und beide schwankten dem Schiffe so matt und entkräftet wieder zu, daß sie geführt werden mußten und auch die folgenden vierzehn Tage hindurch auf ihren Füßen nicht stehen konnten. Zur
werden mußten und auch die folgenden vierzehn Tage hindurch auf ihren Füßen nicht stehen konnten. Zur Arbeit blieben sie mir also während dieser Zeit allerdings unbrauchbar, aber auch ihre Tollheit war gänzlich
Arbeit blieben sie mir also während dieser Zeit allerdings unbrauchbar, aber auch ihre Tollheit war gänzlich von ihnen gewichen, und des Barbiers Kunststück hatte sich als vollkommen probat erwiesen.
von ihnen gewichen, und des Barbiers Kunststück hatte sich als vollkommen probat erwiesen. 12. Kapitel, Meersburg, Leipzig 1930
12. Kapitel, Meersburg, Leipzig 1930 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Gottfried Wilhelm Rabener: Satiren
Gottfried Wilhelm Rabener: Satiren Dieser unvermuthete Anblick setzte mich in Erstaunen. Ich machte vor Verwunderung ein paar so große
Dieser unvermuthete Anblick setzte mich in Erstaunen. Ich machte vor Verwunderung ein paar so große Augen, wie ein Würzkrämer in Ritzebüttel, wenn er in seinem Leben zum erstenmale auf die Börse nach
Augen, wie ein Würzkrämer in Ritzebüttel, wenn er in seinem Leben zum erstenmale auf die Börse nach Hamburg kömmt.
Hamburg kömmt. 8. Auflage, Leipzig, im Verlag der Dyckischen Buchhandlung, 1764
8. Auflage, Leipzig, im Verlag der Dyckischen Buchhandlung, 1764 ______________________________________________________________________________________
Freiherr Ferdinand von Rast: Das Leben des Freiherrn Ferdinand von Rast
1802:
Da wir starke» Nordwest-Wind hatten und es sehr stürmisch war, mußte ich wegen Unwohlseins den ganzen
______________________________________________________________________________________
Freiherr Ferdinand von Rast: Das Leben des Freiherrn Ferdinand von Rast
1802:
Da wir starke» Nordwest-Wind hatten und es sehr stürmisch war, mußte ich wegen Unwohlseins den ganzen Tag auf dem Verdeck bleiben. Bei Stade legten wir an, und in Ritzebüttel, nur 10 Minuten von Cuxhaven,
Tag auf dem Verdeck bleiben. Bei Stade legten wir an, und in Ritzebüttel, nur 10 Minuten von Cuxhaven, mußten wir so lange verweilen, bis das Schiff weitersegeln konnte. Endlich Morgens um 6 Uhr langten wir in
mußten wir so lange verweilen, bis das Schiff weitersegeln konnte. Endlich Morgens um 6 Uhr langten wir in Cuxhaven am.
Cuxhaven am. Wir erfuhren dort, daß das Packetboot bereits um 4 Uhr abgesegelt sei, und mußten daher das nächste
Wir erfuhren dort, daß das Packetboot bereits um 4 Uhr abgesegelt sei, und mußten daher das nächste Packetboot abwarten, was uns mehrere Tage zurückhielt. Wir logirten in Ritzebüttel in der „Stadt Hamburg"
Packetboot abwarten, was uns mehrere Tage zurückhielt. Wir logirten in Ritzebüttel in der „Stadt Hamburg" und amüsirten uns in mannigfacher Weise. Nachdem wir unter angenehmen Gesprächen zu Mittag geges-
und amüsirten uns in mannigfacher Weise. Nachdem wir unter angenehmen Gesprächen zu Mittag geges- sen und unserer Lieben in der Heimath gedachten, erfuhren wir Nachmittags im Kaffeehaus Näheres über
sen und unserer Lieben in der Heimath gedachten, erfuhren wir Nachmittags im Kaffeehaus Näheres über die Verhältnisse auf unserm Packetboot und bestellten unsere Plätze. Am Hafen besichtigten wir den
die Verhältnisse auf unserm Packetboot und bestellten unsere Plätze. Am Hafen besichtigten wir den Leuchtthurm, und vernahmen, daß der sehr heftige Wind mehrere Schiffe zum Stranden gebracht hatte. Bis
Leuchtthurm, und vernahmen, daß der sehr heftige Wind mehrere Schiffe zum Stranden gebracht hatte. Bis zum 4. Juli Morgens war es noch stürmisch und conträrer Wind. Nachmittags waren in unserm Wirthshaus
zum 4. Juli Morgens war es noch stürmisch und conträrer Wind. Nachmittags waren in unserm Wirthshaus der Capitain eines verunglückten Schiffes `The Hope´ nebst 5 Matrosen angekommen. Sie hatten ihr Schiff
der Capitain eines verunglückten Schiffes `The Hope´ nebst 5 Matrosen angekommen. Sie hatten ihr Schiff verlassen müssen und sich mit nur sehr wenigen Effecten in einer Schaluppe gerettet.
verlassen müssen und sich mit nur sehr wenigen Effecten in einer Schaluppe gerettet. Die armen Leute hatten viel erdulden müssen und kaum so viel gerettet, um nach England zurückkehren zu
Die armen Leute hatten viel erdulden müssen und kaum so viel gerettet, um nach England zurückkehren zu können. Der Capitain, den wir zum Abendessen eingeladen hatten, erzählte uns dabei die Details des bekla-
können. Der Capitain, den wir zum Abendessen eingeladen hatten, erzählte uns dabei die Details des bekla- genswerthen Ereignisses.
genswerthen Ereignisses. Als andern Tags der Sturm nachließ, beschloß unser Capitain, am nächsten Morgen abzusegeln. Wir ordne-
Als andern Tags der Sturm nachließ, beschloß unser Capitain, am nächsten Morgen abzusegeln. Wir ordne- ten unsere Effecten und am 6. Juli früh Morgens traten wir die Weiterreise an. Das Wetter war zwar schön,
ten unsere Effecten und am 6. Juli früh Morgens traten wir die Weiterreise an. Das Wetter war zwar schön, aber der Wind war keineswegs der günstigste. Als wir bis nahe bei Neuwerk gekommen waren, mußten wir
aber der Wind war keineswegs der günstigste. Als wir bis nahe bei Neuwerk gekommen waren, mußten wir wegen des heftigen und ungünstigen Windes wirklich wieder umkehren und kamen halb 10 Uhr wieder nach
wegen des heftigen und ungünstigen Windes wirklich wieder umkehren und kamen halb 10 Uhr wieder nach Ritzebüttel zurück.
Ritzebüttel zurück. Am 7. Juli fuhr ich Vormittags mit den Herren Friedländer und Lehmann nach dem Strand, um die dort lie-
Am 7. Juli fuhr ich Vormittags mit den Herren Friedländer und Lehmann nach dem Strand, um die dort lie- genden gestrandeten Güter zu sehen, und Nachmittags um 2 Uhr waren wir wieder in Ritzebüttel angelangt.
genden gestrandeten Güter zu sehen, und Nachmittags um 2 Uhr waren wir wieder in Ritzebüttel angelangt. Endlich am 8. Morgens hatte der Wind sich günstiger gewendet, und wir gingen Nachmittags 5 Uhr an Bord
Endlich am 8. Morgens hatte der Wind sich günstiger gewendet, und wir gingen Nachmittags 5 Uhr an Bord unseres Schiffes. Wir waren nur unser sechs Passagiere, darunter auch der am 3. mit seinem Schiffe verun-
unseres Schiffes. Wir waren nur unser sechs Passagiere, darunter auch der am 3. mit seinem Schiffe verun- glückte Capitain.
glückte Capitain. Anfangs war unsere Gesellschaft ziemlich vergnügt, aber nach ein paar Stunden auf der See wurde ich von
Anfangs war unsere Gesellschaft ziemlich vergnügt, aber nach ein paar Stunden auf der See wurde ich von der Seekrankheit auf's hestigste ergriffen und mußte mich niederlegen. Bald erkrankten auch meine Reise-
der Seekrankheit auf's hestigste ergriffen und mußte mich niederlegen. Bald erkrankten auch meine Reise- gefährten; der Wind drehte sich dabei wiederum unserm Schiffe sehr feindselig und bis zur Nacht am 10.
gefährten; der Wind drehte sich dabei wiederum unserm Schiffe sehr feindselig und bis zur Nacht am 10. wurde es so stürmisch, daß wir nicht mehr glaubten, davon zu kommen. Der Sturm warf unser Schiff hin und
wurde es so stürmisch, daß wir nicht mehr glaubten, davon zu kommen. Der Sturm warf unser Schiff hin und her, — und dabei das Elend der Seekrankheit! Genießen konnte ich gar nichts, und schon der Anblick von
her, — und dabei das Elend der Seekrankheit! Genießen konnte ich gar nichts, und schon der Anblick von Speisen erregte mir Ekel. Der Geruch einer Limone belebte mich ein wenig und eine Flasche Rothwein, die
Speisen erregte mir Ekel. Der Geruch einer Limone belebte mich ein wenig und eine Flasche Rothwein, die ich aus Ritzebüttel mitgenommen hatte, diente mir zunächst zur Nahrung. Nachmittags gab mir auch ein
ich aus Ritzebüttel mitgenommen hatte, diente mir zunächst zur Nahrung. Nachmittags gab mir auch ein Glas Porter die Stärkung, deren ich bedurfte.
Glas Porter die Stärkung, deren ich bedurfte. Die Verzögerung, welche wir in Ritzebüttel wegen des widrigen Windes hatten ertragen müssen und das
Die Verzögerung, welche wir in Ritzebüttel wegen des widrigen Windes hatten ertragen müssen und das körperliche Leiden, Beides machte auf mich einen sehr niederbeugenden Eindruck, der bei meiner Jugend
körperliche Leiden, Beides machte auf mich einen sehr niederbeugenden Eindruck, der bei meiner Jugend und durch die Umstände wohl erklärlich war. Die lebhafte Erinnerung an die Erzählung des Capitains von
und durch die Umstände wohl erklärlich war. Die lebhafte Erinnerung an die Erzählung des Capitains von dem verunglückten Schiffe steigerte meinen angstvollen Zustand bis zu Fieberphantasien, in denen mich
dem verunglückten Schiffe steigerte meinen angstvollen Zustand bis zu Fieberphantasien, in denen mich Untergang und Tod fortwährend bedrohten.
Untergang und Tod fortwährend bedrohten. Commissions - Verlag der U. G. Riemann´schen Hofbuchhandlung, Coburg, 1865
Commissions - Verlag der U. G. Riemann´schen Hofbuchhandlung, Coburg, 1865 ______________________________________________________________________________________
Johann Christoph Sachse: Der deutsche Gil Blas
______________________________________________________________________________________
Johann Christoph Sachse: Der deutsche Gil Blas - Zweiter Abschnitt: Reise zu Wasser nach Cuxhaven -
- Zweiter Abschnitt: Reise zu Wasser nach Cuxhaven - Im März des Jahres 1781 kam Befehl, daß die Truppen sich zum Absegeln bereithalten sollten. Von dieser
Im März des Jahres 1781 kam Befehl, daß die Truppen sich zum Absegeln bereithalten sollten. Von dieser Zeit an verging fast nicht ein Tag, an dem nicht eine Exekution vorgefallen wäre.
Zeit an verging fast nicht ein Tag, an dem nicht eine Exekution vorgefallen wäre. In den ersten Tagen des April wurden die Truppen wirklich eingeschifft und gingen nach Ritzebüttel ab,
In den ersten Tagen des April wurden die Truppen wirklich eingeschifft und gingen nach Ritzebüttel ab, wohin ich mich mit meinem jungen Herrn gleichfalls in einem Boote begab, weil derselbe diese Gelegenheit
wohin ich mich mit meinem jungen Herrn gleichfalls in einem Boote begab, weil derselbe diese Gelegenheit benutzen wollte, um eine Reise nach England zu machen.
benutzen wollte, um eine Reise nach England zu machen. Auf den Schiffen befanden sich eine Menge Soldaten, welche mit Gewalt zu der Expedition nach Amerika
Auf den Schiffen befanden sich eine Menge Soldaten, welche mit Gewalt zu der Expedition nach Amerika weggenommen worden oder sonst mit ihrer Lage unzufrieden waren. Da die Schiffe bei Cuxhaven einige
weggenommen worden oder sonst mit ihrer Lage unzufrieden waren. Da die Schiffe bei Cuxhaven einige Tage stilliegen mußten, so gingen daselbst die Herren Offiziere ans Land, um sich's noch wohl sein zu
Tage stilliegen mußten, so gingen daselbst die Herren Offiziere ans Land, um sich's noch wohl sein zu lassen. Dadurch erhielten die Mißvergnügten Gelegenheit, sich miteinander wegen der Desertion zu
lassen. Dadurch erhielten die Mißvergnügten Gelegenheit, sich miteinander wegen der Desertion zu beratschlagen, worüber ein ganzes Bataillon sich vereinigte. Demnach gingen immer je dreißig und dreißig
beratschlagen, worüber ein ganzes Bataillon sich vereinigte. Demnach gingen immer je dreißig und dreißig Mann unter der Androhung vom Schiffe, den wachthabenden Offizier zu erschießen, wofern er den
Mann unter der Androhung vom Schiffe, den wachthabenden Offizier zu erschießen, wofern er den geringsten Lärm machen würde.
geringsten Lärm machen würde. Schon hatten die ersten dreißig Mann einen ziemlichen Vorsprung gewonnen, als der Desertionsversuch der
Schon hatten die ersten dreißig Mann einen ziemlichen Vorsprung gewonnen, als der Desertionsversuch der folgenden von einem andern Schiffe aus bemerkt und deswegen Lärm gemacht wurde, worauf sogleich ein
folgenden von einem andern Schiffe aus bemerkt und deswegen Lärm gemacht wurde, worauf sogleich ein Kommando Kavallerie den Flüchtigen nachsetzen mußte. Diese waren beinahe schon bis Preußisch-Minden
Kommando Kavallerie den Flüchtigen nachsetzen mußte. Diese waren beinahe schon bis Preußisch-Minden gekommen und saßen sorglos und ruhig in einer Schenke, als die Kavallerie sie überraschte und, weil sie
gekommen und saßen sorglos und ruhig in einer Schenke, als die Kavallerie sie überraschte und, weil sie ihre Gewehre abgelegt hatten, gefangennahm.
ihre Gewehre abgelegt hatten, gefangennahm. Während dies geschah, empörte sich die sämtliche Mannschaft aller Schiffe und widersetzte sich dem
Während dies geschah, empörte sich die sämtliche Mannschaft aller Schiffe und widersetzte sich dem Weitersegeln, wodurch der Kommandant von Wangenheim, so glaub ich, hieß er, sich genötigt sah, nach
Weitersegeln, wodurch der Kommandant von Wangenheim, so glaub ich, hieß er, sich genötigt sah, nach Stade zurückschiffen zu lassen.
Stade zurückschiffen zu lassen. ______________________________________________________________________________________
Bernhard Schröder: Erinnerungen 1927 – 1945
Nach sechs Wochen, es war Mitte August (1941), hieß es für mich wieder den Seesack packen: abkomman-
______________________________________________________________________________________
Bernhard Schröder: Erinnerungen 1927 – 1945
Nach sechs Wochen, es war Mitte August (1941), hieß es für mich wieder den Seesack packen: abkomman- diert nach Nordholz, Zentralfunkstelle Deutsche Bucht, Leiter: Kapitän Mannhenke. Ihm unterstanden außer-
diert nach Nordholz, Zentralfunkstelle Deutsche Bucht, Leiter: Kapitän Mannhenke. Ihm unterstanden außer- dem noch die Signalstelle Cuxhaven und die B-Dienststelle Altenwalde.
dem noch die Signalstelle Cuxhaven und die B-Dienststelle Altenwalde. Erst einmal hieß es Abschied nehmen von Borkum. Mit dem Versorgungsboot nach Emden. Dann wieder mit
Erst einmal hieß es Abschied nehmen von Borkum. Mit dem Versorgungsboot nach Emden. Dann wieder mit der Bahn über Oldenburg, Bremen. Wesermünde nach Nordholz. Gleich nebenan lag der Flugplatz Wurster-
der Bahn über Oldenburg, Bremen. Wesermünde nach Nordholz. Gleich nebenan lag der Flugplatz Wurster- heide.
heide. Es war ein warmer Tag. Die Heide machte ihrem Namen alle Ehre. Der Flugplatz, auf dem das „Pik As"-
Es war ein warmer Tag. Die Heide machte ihrem Namen alle Ehre. Der Flugplatz, auf dem das „Pik As"- Jagdgeschwader gelegen hatte, war nach der Umgruppierung in Stille versunken.
Jagdgeschwader gelegen hatte, war nach der Umgruppierung in Stille versunken. Das Haus, in dem die Funkstation untergebracht war, lag an der Straße nach Cuxhaven. Ich meldete mich
Das Haus, in dem die Funkstation untergebracht war, lag an der Straße nach Cuxhaven. Ich meldete mich beim wachhabenden Funkmaat. Einen Laufzettel brauchte ich dieses mal nicht. Es war alles in einem Ge-
beim wachhabenden Funkmaat. Einen Laufzettel brauchte ich dieses mal nicht. Es war alles in einem Ge- bäude. Der Maat übergab die Aufsicht über den Funkraum einem Obergefreiten und ging mit mir in den
bäude. Der Maat übergab die Aufsicht über den Funkraum einem Obergefreiten und ging mit mir in den Schlaftrakt, wo die Funkgasten untergebracht waren. Hier stellte ich meinen Seesack ab.
Schlaftrakt, wo die Funkgasten untergebracht waren. Hier stellte ich meinen Seesack ab. Darauf wurden Spind und Koje inspiziert. Es war alles etwas großzügiger gehalten. Anschließend Wasch-
Darauf wurden Spind und Koje inspiziert. Es war alles etwas großzügiger gehalten. Anschließend Wasch- raum, Essraum, Funkeinrichtung und die Gebäude, in denen die Funkmaaten ihr Domizil hatten, besichtigt.
raum, Essraum, Funkeinrichtung und die Gebäude, in denen die Funkmaaten ihr Domizil hatten, besichtigt. „Morgen früh ist um 7.00 Uhr Appell“, damit blieb ich mir selbst überlassen. Das heißt, allein war ich nicht,
„Morgen früh ist um 7.00 Uhr Appell“, damit blieb ich mir selbst überlassen. Das heißt, allein war ich nicht, denn die Funker der Freiwache wollten doch sehen, was da für ein Neuer gekommen war. Man stand mir mit
denn die Funker der Freiwache wollten doch sehen, was da für ein Neuer gekommen war. Man stand mir mit Rat und Tat zur Seite. Spind einräumen, Bett beziehen, nachdem ich vom Oberfunkmeister das Bettzeug in
Rat und Tat zur Seite. Spind einräumen, Bett beziehen, nachdem ich vom Oberfunkmeister das Bettzeug in Empfang genommen hatte und für den Abend noch meine Fourage überreicht bekam.
Empfang genommen hatte und für den Abend noch meine Fourage überreicht bekam. Der Oberfunkmeister wohnte in einem Haus gegenüber der Funkstelle auf der anderen Straßenseite und
Der Oberfunkmeister wohnte in einem Haus gegenüber der Funkstelle auf der anderen Straßenseite und hatte die Stelle der „Mutter der Kompanie" inne. Er sorgte für alles was die Funkstelle betraf.
hatte die Stelle der „Mutter der Kompanie" inne. Er sorgte für alles was die Funkstelle betraf. Hier wurde ich nun in den allgemeinen Funkdienst integriert. Am anderen Morgen wurde ich als Neuzugang
Hier wurde ich nun in den allgemeinen Funkdienst integriert. Am anderen Morgen wurde ich als Neuzugang dem Stellenpersonal vorgestellt.
dem Stellenpersonal vorgestellt. Jeden Morgen wurde die Fahne vor dem Haus gehisst, des Abends um 18.00 Uhr wieder eingeholt. Diese
Jeden Morgen wurde die Fahne vor dem Haus gehisst, des Abends um 18.00 Uhr wieder eingeholt. Diese Prozedur wurde von zwei Mannschaftsdienstgraden durchgeführt. Ca. zwanzig Mann bevölkerten diese
Prozedur wurde von zwei Mannschaftsdienstgraden durchgeführt. Ca. zwanzig Mann bevölkerten diese Dienststelle, vom Oberfunkmeister bis zum Funkgast. Ich war, wie auf Borkum, auch hier der jüngste.
Dienststelle, vom Oberfunkmeister bis zum Funkgast. Ich war, wie auf Borkum, auch hier der jüngste. Beim Kapitän melden hieß es am anderen Tag. Im „Allerheiligsten" des Funkstellenleiters Deutsche Bucht,
Beim Kapitän melden hieß es am anderen Tag. Im „Allerheiligsten" des Funkstellenleiters Deutsche Bucht, Herrn Kapitän Mannhenke meldete ich mich. „Funkgast Schröder zur Stelle." „Stehen sie bequem."
Herrn Kapitän Mannhenke meldete ich mich. „Funkgast Schröder zur Stelle." „Stehen sie bequem." Darauf stellte er mir Fragen die mein Elternhaus, meinen Beruf betrafen, wie ich auf den Gedanken gekom-
Darauf stellte er mir Fragen die mein Elternhaus, meinen Beruf betrafen, wie ich auf den Gedanken gekom- men war, als Funker zur Marine zu gehen, nach meinem Seesportfunkzeugnis und dergleichen mehr. Dann
men war, als Funker zur Marine zu gehen, nach meinem Seesportfunkzeugnis und dergleichen mehr. Dann entließ er mich.
entließ er mich. Abgesehen von den Aktivitäten in der Deutschen Bucht, waren wir weit vom Kriegsgeschehen entfernt, in
Abgesehen von den Aktivitäten in der Deutschen Bucht, waren wir weit vom Kriegsgeschehen entfernt, in diesem Monat August 1941.
diesem Monat August 1941. Gegenüber der Funkstelle, sie war übrigens mit einem Jägerzaun zur Straßenseite eingefriedigt, lag unter
Gegenüber der Funkstelle, sie war übrigens mit einem Jägerzaun zur Straßenseite eingefriedigt, lag unter anderem ein Privathaus, in dem die Maaten und ein paar Obergefreite wohnten. Man gelangte über eine
anderem ein Privathaus, in dem die Maaten und ein paar Obergefreite wohnten. Man gelangte über eine hölzerne Brücke, die einen Graben überspannte, dorthin. Diese Brücke hatte etwas mit unserem Freizeit-
hölzerne Brücke, die einen Graben überspannte, dorthin. Diese Brücke hatte etwas mit unserem Freizeit- verhalten zu tun. Es war uns zur Gewohnheit geworden des Abends, wenn wir unseren Klön machten, auf
verhalten zu tun. Es war uns zur Gewohnheit geworden des Abends, wenn wir unseren Klön machten, auf dem Geländer zu sitzen und dabei Land und Leute zu beobachten.
dem Geländer zu sitzen und dabei Land und Leute zu beobachten. Jetzt kommt das tolle Stück weswegen ich die Brücke ins Spiel bringe. Um 18.00 Uhr wurde die Fahne ge-
Jetzt kommt das tolle Stück weswegen ich die Brücke ins Spiel bringe. Um 18.00 Uhr wurde die Fahne ge- genüber, vor dem Hauptgebäude, von zwei wachhabenden Funkern eingeholt. Jetzt hätte es sich gehört,
genüber, vor dem Hauptgebäude, von zwei wachhabenden Funkern eingeholt. Jetzt hätte es sich gehört, beim Achtung und Niederholen der Fahne vom Geländer auf dem wir saßen herunterzusteigen, Haltung
beim Achtung und Niederholen der Fahne vom Geländer auf dem wir saßen herunterzusteigen, Haltung anzunehmen und die Fahne zu grüßen (Ehrenbezeugung). Statt dessen ging einer nach dem anderen ins
anzunehmen und die Fahne zu grüßen (Ehrenbezeugung). Statt dessen ging einer nach dem anderen ins Haus. Nachdem die Zeremonie beendet war, saßen plötzlich alle wieder auf ihren alten Plätzen. Da jeder mit
Haus. Nachdem die Zeremonie beendet war, saßen plötzlich alle wieder auf ihren alten Plätzen. Da jeder mit der Zeremonie im Laufe der Woche befasst war, so dachten wir uns nichts weiter dabei. Das ging eine ge-
der Zeremonie im Laufe der Woche befasst war, so dachten wir uns nichts weiter dabei. Das ging eine ge- wisse Zeit so weiter.
wisse Zeit so weiter. Eines Morgens beim Appell hielt uns der Kapitän eine Standpauke.
Eines Morgens beim Appell hielt uns der Kapitän eine Standpauke. „Meine Herren! Also so geht das nicht. Es ist doch nicht zuviel verlangt beim Einholen der Fahne in Achtung
„Meine Herren! Also so geht das nicht. Es ist doch nicht zuviel verlangt beim Einholen der Fahne in Achtung zu stehen, wobei es doch höchstens nur drei Minuten in Anspruch nimmt."
zu stehen, wobei es doch höchstens nur drei Minuten in Anspruch nimmt." Im Stillen hatte er für unser Verhalten sicher Verständnis. Wenn er nicht von einem hundertprozentigen Par-
Im Stillen hatte er für unser Verhalten sicher Verständnis. Wenn er nicht von einem hundertprozentigen Par- teigenossen angesprochen worden wäre, hätte das sicher so weitergehen können.
teigenossen angesprochen worden wäre, hätte das sicher so weitergehen können. Auf der Funkstelle Nordholz wurde ich unter anderem mit dem Verschlüsseln von Funksprüchen vertraut ge-
Auf der Funkstelle Nordholz wurde ich unter anderem mit dem Verschlüsseln von Funksprüchen vertraut ge- macht. Die „Enigma", eine Verschlüsselungsmaschine, galt als nicht zu knacken.
macht. Die „Enigma", eine Verschlüsselungsmaschine, galt als nicht zu knacken. Mein Ft-Hören und -Geben vervollkommnete sich zusehends. Die Q-Gruppen mussten gelernt werden. In
Mein Ft-Hören und -Geben vervollkommnete sich zusehends. Die Q-Gruppen mussten gelernt werden. In der Freiwache machten wir unsere Landgänge durch die Wurster Heide bis zum Ort Spika, wo ein Kino
der Freiwache machten wir unsere Landgänge durch die Wurster Heide bis zum Ort Spika, wo ein Kino betrieben wurde. Ansonsten war nichts los. Schöne Spätsommertage ließen mich die Zeit vergessen. Hin
betrieben wurde. Ansonsten war nichts los. Schöne Spätsommertage ließen mich die Zeit vergessen. Hin und wieder gab es Fliegeralarm.
und wieder gab es Fliegeralarm. Ich war ca. acht Wochen in Nordholz, es war im Oktober, da erhielt ich den Befehl, mich Morgens beim Ka-
Ich war ca. acht Wochen in Nordholz, es war im Oktober, da erhielt ich den Befehl, mich Morgens beim Ka- pitän Mannhenke zu melden. Ich also rein zum Kapitän, die übliche Meldung gemacht: „Stehen sie bequem!"
pitän Mannhenke zu melden. Ich also rein zum Kapitän, die übliche Meldung gemacht: „Stehen sie bequem!" In ganz zivilem Ton sprach er mit mir.
In ganz zivilem Ton sprach er mit mir. „Na, Funkgast Schröder, was halten sie davon, wenn ich sie nach Altenwalde zum B-Dienst versetze."
„Na, Funkgast Schröder, was halten sie davon, wenn ich sie nach Altenwalde zum B-Dienst versetze." „Herr Kapitän," antwortete ich „meiner Meinung nach sollte ich einmal zu den schwimmenden Verbänden
„Herr Kapitän," antwortete ich „meiner Meinung nach sollte ich einmal zu den schwimmenden Verbänden kommen.“
kommen.“ „Ach" sagte er, „mein lieber Junge, der Krieg dauert noch lange, gehe mal erst nach Altenwalde.“ Damit
„Ach" sagte er, „mein lieber Junge, der Krieg dauert noch lange, gehe mal erst nach Altenwalde.“ Damit entließ er mich.
entließ er mich. Am gleichen Tag packte ich erneut meinen Seesack. Ein tägliches Kurierfahrzeug brachte mich sodann zur
Am gleichen Tag packte ich erneut meinen Seesack. Ein tägliches Kurierfahrzeug brachte mich sodann zur B-Dienstfunkstelle, etwas näher an Cuxhaven heran. In der Nähe lag die Küstenfunkstelle „Elbe-Weser-Ra-
B-Dienstfunkstelle, etwas näher an Cuxhaven heran. In der Nähe lag die Küstenfunkstelle „Elbe-Weser-Ra- dio", „D.A.W." (Dora Anton Willi)
dio", „D.A.W." (Dora Anton Willi) Es war insofern keine große Umstellung, weil der Oberfunkmeister der in Nordholz die „Mutter" war, auch auf
Es war insofern keine große Umstellung, weil der Oberfunkmeister der in Nordholz die „Mutter" war, auch auf dieser Funkstelle den Ablauf des militärischen Lebens bestimmte. Die übliche Prozedur des Kennenlernens
dieser Funkstelle den Ablauf des militärischen Lebens bestimmte. Die übliche Prozedur des Kennenlernens und Einweisens wurde mir langsam zur Routine.
und Einweisens wurde mir langsam zur Routine. Auf dieser FT- Stelle konnte ich die „Gebetaste" an den berühmten „Haken" hängen. Hier kam es darauf an,
Auf dieser FT- Stelle konnte ich die „Gebetaste" an den berühmten „Haken" hängen. Hier kam es darauf an, das Gehör noch mehr zu schärfen, galt es doch die englischen Funkwellen zu überwachen.
das Gehör noch mehr zu schärfen, galt es doch die englischen Funkwellen zu überwachen. Die Hälfte der Leute waren alte „Debeg-Funker" (Deutsche Berufsfunker Genossenschaft), also Funker auf
Die Hälfte der Leute waren alte „Debeg-Funker" (Deutsche Berufsfunker Genossenschaft), also Funker auf Schiffen in Friedenszeiten. Sie waren als Obermaaten und Funkmeister bei der Kriegsmarine eingestellt.
Schiffen in Friedenszeiten. Sie waren als Obermaaten und Funkmeister bei der Kriegsmarine eingestellt. Mittlerweile konnte ich mir einen Winkel zu meinem Blitz auf die Ärmel nähen. Ich war jetzt Funkgefreiter. Mit
Mittlerweile konnte ich mir einen Winkel zu meinem Blitz auf die Ärmel nähen. Ich war jetzt Funkgefreiter. Mit den anderen Funkern hatte sich bald ein prima Verhältnis aufgebaut. An Freiwachen gingen wir in die Knei-
den anderen Funkern hatte sich bald ein prima Verhältnis aufgebaut. An Freiwachen gingen wir in die Knei- pen und machten einen auf Alt.
pen und machten einen auf Alt. In Altenwalde gab es zu der Zeit drei Kneipen. „Mutter Elli", „Heinsohn" und „Schröder". Da wurde dann
In Altenwalde gab es zu der Zeit drei Kneipen. „Mutter Elli", „Heinsohn" und „Schröder". Da wurde dann geknobelt, Skat gespielt und erzählt.
geknobelt, Skat gespielt und erzählt. Hinter der Gastwirtschaft „Schröder" gab es eine hohe Sanddüne mit anschließender Heide. Hin und wieder
Hinter der Gastwirtschaft „Schröder" gab es eine hohe Sanddüne mit anschließender Heide. Hin und wieder wurde unsere „Kampfkraft" hier geprüft. Damit die faulen Knochen nicht einrosten hieß es dann „auf den
wurde unsere „Kampfkraft" hier geprüft. Damit die faulen Knochen nicht einrosten hieß es dann „auf den Sandberg, Marsch Marsch". Nach einer halben Stunde hatte der Oberfunkmeister keine Lust mehr und wir
Sandberg, Marsch Marsch". Nach einer halben Stunde hatte der Oberfunkmeister keine Lust mehr und wir kehrten zum Glas Bier in die Wirtschaft ein.
kehrten zum Glas Bier in die Wirtschaft ein. „Da sprach der Scheich zum Emir: trinken wir eins und dann gehen wir, da sprach der Emir zum Scheich:
„Da sprach der Scheich zum Emir: trinken wir eins und dann gehen wir, da sprach der Emir zum Scheich: trinken wir noch eins und dann gehen wir gleich."
trinken wir noch eins und dann gehen wir gleich." Auf diesen Spruch hin hatte ich meinen Namen weg: „Scheich", ein Osnabrücker.
Auf diesen Spruch hin hatte ich meinen Namen weg: „Scheich", ein Osnabrücker. Fortan, wenn vom „Scheich" die Rede war, wusste jeder wer gemeint war. Sowie „Bommel" Pirschek, ein
Fortan, wenn vom „Scheich" die Rede war, wusste jeder wer gemeint war. Sowie „Bommel" Pirschek, ein Berliner, „Dabbelju" Dahnke, ein Hamburger, „Emir" Emst Pfingsten aus Düsseldorf, Walter Dahn aus Dres-
Berliner, „Dabbelju" Dahnke, ein Hamburger, „Emir" Emst Pfingsten aus Düsseldorf, Walter Dahn aus Dres- den. Wir waren schon ein toller Verein „Stenze und Tätowierer", „Jede Menge Barcelona" und andere Sprü-
den. Wir waren schon ein toller Verein „Stenze und Tätowierer", „Jede Menge Barcelona" und andere Sprü- che wurden gedroschen.
che wurden gedroschen. Es war mittlerweile Dezember, der tägliche Dienstablauf war mir zur Routine geworden.
Es war mittlerweile Dezember, der tägliche Dienstablauf war mir zur Routine geworden. Auf dem Adcock-Peiler, dieser stand etwa 150 Meter von der Funkbaracke entfernt im freien Feld, hatte ich
Auf dem Adcock-Peiler, dieser stand etwa 150 Meter von der Funkbaracke entfernt im freien Feld, hatte ich meine ersten Wachen mit einem FT-Maat geschoben. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich ein ausge-
meine ersten Wachen mit einem FT-Maat geschoben. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich ein ausge- zeichnetes Gehör hatte. Es war gar nicht so einfach auf der Kurzwelle, wo mehrere Sender dicht nebenein-
zeichnetes Gehör hatte. Es war gar nicht so einfach auf der Kurzwelle, wo mehrere Sender dicht nebenein- ander lagen, den zu erfassenden herauszufiltern und die Morsezeichen zu Papier zu bringen.
ander lagen, den zu erfassenden herauszufiltern und die Morsezeichen zu Papier zu bringen. Der Winter 1941/42 war ein geradezu extrem kalter und schneereicher. Die Funkstation, die etwa 200 Meter
Der Winter 1941/42 war ein geradezu extrem kalter und schneereicher. Die Funkstation, die etwa 200 Meter von der Straße nach Cuxhaven entfernt in einer Senke lag, war eines Morgens bis unterhalb der Dachtraufe
von der Straße nach Cuxhaven entfernt in einer Senke lag, war eines Morgens bis unterhalb der Dachtraufe im Schnee versunken.
im Schnee versunken. „Alle Mann raus zum Schneeschieben!"
„Alle Mann raus zum Schneeschieben!" Erst einmal bis zur Straße freimachen, damit der Personenverkehr gewährleistet wurde. Links und rechts des
Erst einmal bis zur Straße freimachen, damit der Personenverkehr gewährleistet wurde. Links und rechts des Weges türmten sich die Wehen zwei Meter hoch. Warm angezogen war es ein Spaß uns richtig loszuarbei-
Weges türmten sich die Wehen zwei Meter hoch. Warm angezogen war es ein Spaß uns richtig loszuarbei- ten. Unser Chef, der Kapitän, kam dann später und war des Lobes voll.
ten. Unser Chef, der Kapitän, kam dann später und war des Lobes voll. Zum Weihnachtsfest wurden Leute gesucht, die freiwillig Funkwache übernahmen. Jetzt und auch später bin
Zum Weihnachtsfest wurden Leute gesucht, die freiwillig Funkwache übernahmen. Jetzt und auch später bin ich am Heiligen Abend immer Funkwache gegangen. Dafür hatte ich dann am Sylvester Freiwache.
ich am Heiligen Abend immer Funkwache gegangen. Dafür hatte ich dann am Sylvester Freiwache. Die Wege von der Wohnbaracke zur Straße, zur Funkbaracke und zum Peiler mussten immer frei gehalten
Die Wege von der Wohnbaracke zur Straße, zur Funkbaracke und zum Peiler mussten immer frei gehalten werden. Die Landschaft sah aus als seien Maulwürfe am Werk gewesen.
werden. Die Landschaft sah aus als seien Maulwürfe am Werk gewesen. Eine herausragende Episode war der Sylvesterabend. Ernst, Walter,
Eine herausragende Episode war der Sylvesterabend. Ernst, Walter, Willi und ich waren bei Heinsohn, der bereits erwähnten Gastwirtschaft,
Willi und ich waren bei Heinsohn, der bereits erwähnten Gastwirtschaft, eingekehrt. Wir wollten einen draufmachen. Bei Grog und Bier fing der
eingekehrt. Wir wollten einen draufmachen. Bei Grog und Bier fing der Abend gut an. Unterhaltung gab es genug. Die Mädchen aus dem Dorf
Abend gut an. Unterhaltung gab es genug. Die Mädchen aus dem Dorf und Umgebung waren auch vertreten. Soldaten einer Artillerieabtei-
und Umgebung waren auch vertreten. Soldaten einer Artillerieabtei- lung, die vorübergehend in Nordholz lagen, konnten es nicht lassen, uns
lung, die vorübergehend in Nordholz lagen, konnten es nicht lassen, uns zu hänseln. Ein Feldwebel tat sich besonders hervor.
zu hänseln. Ein Feldwebel tat sich besonders hervor. Im Jahr 1941/42 konnte man noch gut und gerne „einen in die Hacken"
Im Jahr 1941/42 konnte man noch gut und gerne „einen in die Hacken" bekommen, will sagen; es gab noch genügend Alkohol um sich zu
bekommen, will sagen; es gab noch genügend Alkohol um sich zu betrinken.
betrinken. Jedenfalls in seinem Suff nannte er uns „nachgemachte Krieger", „Bubikragenträger" und so weiter. Wir ver-
Jedenfalls in seinem Suff nannte er uns „nachgemachte Krieger", „Bubikragenträger" und so weiter. Wir ver- wahrten uns gegen diese Ausdrücke. Da wurde der Mensch noch erboster. Die anwesenden Artilleristen
wahrten uns gegen diese Ausdrücke. Da wurde der Mensch noch erboster. Die anwesenden Artilleristen wollten ihn beruhigen, er aber zog eine Pistole und fuchtelte damit in der Gegend herum.
wollten ihn beruhigen, er aber zog eine Pistole und fuchtelte damit in der Gegend herum. Wir verließen auf die Schnelle das Lokal und begaben uns zur Funkstelle. Unser Stellenleiter, ein Ober-
Wir verließen auf die Schnelle das Lokal und begaben uns zur Funkstelle. Unser Stellenleiter, ein Ober- fähnrich, als er uns sah: „Na, habt ihr schon genug, dass ihr schon wieder hier seid?"
fähnrich, als er uns sah: „Na, habt ihr schon genug, dass ihr schon wieder hier seid?" Es begann das Erzählen unseres Erlebnisses.
Es begann das Erzählen unseres Erlebnisses. „Das geht ja nun nicht, wartet einen Moment, ich komme mit und werde mir den Herren mal vorknöpfen."
„Das geht ja nun nicht, wartet einen Moment, ich komme mit und werde mir den Herren mal vorknöpfen." In der Gastwirtschaft Heinsohn ging es hoch her als wir mit dem Stellenleiter eintraten. Augenblicklich kehrte
In der Gastwirtschaft Heinsohn ging es hoch her als wir mit dem Stellenleiter eintraten. Augenblicklich kehrte Ruhe ein. Der Feldwebel musste seine Pistole unserem Vorgesetzten aushändigen. Es gab noch ein hin und
Ruhe ein. Der Feldwebel musste seine Pistole unserem Vorgesetzten aushändigen. Es gab noch ein hin und her von Fragen und Antworten, dann schloss unser Stellenleiter mit den Worten: „Sie können sich ihre Pisto-
her von Fragen und Antworten, dann schloss unser Stellenleiter mit den Worten: „Sie können sich ihre Pisto- le beim Kapitän Mannhenke abholen, wenn sie wieder nüchtern sind."
le beim Kapitän Mannhenke abholen, wenn sie wieder nüchtern sind." Sylvester haben wir dann in der Station weitergefeiert. Von unserer Marketenderware hatten wir noch Vorrä-
Sylvester haben wir dann in der Station weitergefeiert. Von unserer Marketenderware hatten wir noch Vorrä- te. Zu den Toilettenartikeln gab es auch immer eine Flasche Bols Likör. Damit begossen wir den Übergang
te. Zu den Toilettenartikeln gab es auch immer eine Flasche Bols Likör. Damit begossen wir den Übergang ins Jahr 1942.
ins Jahr 1942. Mein Kumpel Emst fragte am darauf folgenden Sonntag, wir hatten Freiwache: „Gehst du mit nach Cuxhaven
Mein Kumpel Emst fragte am darauf folgenden Sonntag, wir hatten Freiwache: „Gehst du mit nach Cuxhaven ins Kino?" Ich wollte.
ins Kino?" Ich wollte. Zuerst schauten wir uns die Elbe bei der „Alten Liebe" an. So große Eisblöcke hatte ich bis dahin noch nicht
Zuerst schauten wir uns die Elbe bei der „Alten Liebe" an. So große Eisblöcke hatte ich bis dahin noch nicht zu Gesicht bekommen. Der ganze Strom war dicht. Es knackte und knarrte wenn sich die Eisschollen über-
zu Gesicht bekommen. Der ganze Strom war dicht. Es knackte und knarrte wenn sich die Eisschollen über- einander schoben. Um das Schauspiel noch länger zu genießen begaben wir uns ins „Pik As", eine Tanzbar,
einander schoben. Um das Schauspiel noch länger zu genießen begaben wir uns ins „Pik As", eine Tanzbar, zu erreichen über eine Brücke, die vom alten Deich in das zweite Obergeschoss eines Hauses führte. Hier
zu erreichen über eine Brücke, die vom alten Deich in das zweite Obergeschoss eines Hauses führte. Hier spielte eine Tanzkapelle. Das Tanzen war allerdings verboten. Nachdem wir ein paar Bier getrunken hatten
spielte eine Tanzkapelle. Das Tanzen war allerdings verboten. Nachdem wir ein paar Bier getrunken hatten sind wir dann ins Kino gegangen.
sind wir dann ins Kino gegangen. Die nächste Zeit war mit Wachegehen (am Empfänger) ausgefüllt. Für mich war die „Mittelwache", einfach
Die nächste Zeit war mit Wachegehen (am Empfänger) ausgefüllt. Für mich war die „Mittelwache", einfach ausgedrückt, unangenehm. Sie betraf die Zeit von Nachts um 01:00 bis 07:00 Uhr Morgens. Die Augen und
ausgedrückt, unangenehm. Sie betraf die Zeit von Nachts um 01:00 bis 07:00 Uhr Morgens. Die Augen und Ohren mussten offen bleiben und das fiel schwer. So lange die Englander Funkverkehr hatten war man an-
Ohren mussten offen bleiben und das fiel schwer. So lange die Englander Funkverkehr hatten war man an- gespannt, sobald längere Pausen eintraten fielen einem die Augen zu. Eine lange Zeit, die zwischen 04:00
gespannt, sobald längere Pausen eintraten fielen einem die Augen zu. Eine lange Zeit, die zwischen 04:00 und 06:00 Uhr.
und 06:00 Uhr. Damit keiner einschlief ging der wachhabende Funkmaat von Zeit zu Zeit durch den Funkraum.
Damit keiner einschlief ging der wachhabende Funkmaat von Zeit zu Zeit durch den Funkraum. Wenn Schnellsendungen auf dem Magnetophonband aufgenommen waren, wurden diese am nächsten Mor-
Wenn Schnellsendungen auf dem Magnetophonband aufgenommen waren, wurden diese am nächsten Mor- gen ins Reine übertragen. Da konnte man das Abhörtempo dann selbst bestimmen.
gen ins Reine übertragen. Da konnte man das Abhörtempo dann selbst bestimmen. Auf der MPS (Marine Peil Stelle) Altenwalde waren in diesem Frühjahr 1942 keine außergewöhnlichen Er-
Auf der MPS (Marine Peil Stelle) Altenwalde waren in diesem Frühjahr 1942 keine außergewöhnlichen Er- eignisse zu melden.
eignisse zu melden. Meinen ersten Heimaturlaub hatte ich auch schon hinter mir. Mein Bruder Georg war zur motorisierten Infan-
Meinen ersten Heimaturlaub hatte ich auch schon hinter mir. Mein Bruder Georg war zur motorisierten Infan- terie eingezogen worden. Ferdinand war mit den Veterinären von Danzig nach Norwegen verlegt worden.
terie eingezogen worden. Ferdinand war mit den Veterinären von Danzig nach Norwegen verlegt worden. Franz war noch auf dem OKD beschäftigt und hatte hier bei einem Luftangriff eine Verletzung erlitten, von
Franz war noch auf dem OKD beschäftigt und hatte hier bei einem Luftangriff eine Verletzung erlitten, von der er ein steifes Bein nachbehielt.
der er ein steifes Bein nachbehielt. Der Laden zu Hause lief weiter, dank der Unverwüstlichkeit meiner Eltern. Mein Vater hatte einen Anhänger
Der Laden zu Hause lief weiter, dank der Unverwüstlichkeit meiner Eltern. Mein Vater hatte einen Anhänger für das Fahrrad gebaut, mit dem er alle noch verfügbaren Produkte für das tägliche Leben herankarrte.
für das Fahrrad gebaut, mit dem er alle noch verfügbaren Produkte für das tägliche Leben herankarrte. Mein Schwager, der bei den Fokke-Wulf-Werken in Bremen beschäftigt war, hatte eine Einberufung zur Flak
Mein Schwager, der bei den Fokke-Wulf-Werken in Bremen beschäftigt war, hatte eine Einberufung zur Flak bekommen. Seine Frau Agnes war nach einem Bombenangriff mit Sack und Pack und ihren Kindern wieder
bekommen. Seine Frau Agnes war nach einem Bombenangriff mit Sack und Pack und ihren Kindern wieder ins Elternhaus nach Eversburg gezogen. Sie unterstützte Mutter und Hanna im Haushalt.
ins Elternhaus nach Eversburg gezogen. Sie unterstützte Mutter und Hanna im Haushalt. Im April 1942 bekam ich Besuch von meinem Bruder Ferdinand auf der MPS. Wir hatten uns seit Weihnach-
Im April 1942 bekam ich Besuch von meinem Bruder Ferdinand auf der MPS. Wir hatten uns seit Weihnach- ten 1939 nicht mehr gesehen, für ein paar Stunden waren wir zusammen, ich hatte zum Glück gerade Frei-
ten 1939 nicht mehr gesehen, für ein paar Stunden waren wir zusammen, ich hatte zum Glück gerade Frei- wache.
wache. Er erzählte seine Erlebnisse bei der Überfährt von Dänemark nach Norwegen. Englische U-Boote hatten den
Er erzählte seine Erlebnisse bei der Überfährt von Dänemark nach Norwegen. Englische U-Boote hatten den Konvoi angegriffen und einige Dampfer versenkt. Er selbst war unversehrt.
Konvoi angegriffen und einige Dampfer versenkt. Er selbst war unversehrt. Neuigkeiten gab es genug in der Familie. Die Zeit verrann im Fluge. Ich habe ihn dann zum Bahnhof ge-
Neuigkeiten gab es genug in der Familie. Die Zeit verrann im Fluge. Ich habe ihn dann zum Bahnhof ge- bracht. Wiedergesehen haben wir uns erst nach dem Kriege.
bracht. Wiedergesehen haben wir uns erst nach dem Kriege. Eines Tages im April oder Mai 1942 machte die halbe Mannschaft einen Trip nach Hamburg. Einmal die
Eines Tages im April oder Mai 1942 machte die halbe Mannschaft einen Trip nach Hamburg. Einmal die Reeperbahn rauf und runter. „Jetzt gehen wir Hippodrom" sagte der begleitende Funkmeister. Für mich alles
Reeperbahn rauf und runter. „Jetzt gehen wir Hippodrom" sagte der begleitende Funkmeister. Für mich alles wieder neue Aspekte. Der Eingang der Herbertstraße wurde natürlich auch besichtigt. Es wurde dort alles
wieder neue Aspekte. Der Eingang der Herbertstraße wurde natürlich auch besichtigt. Es wurde dort alles auf kleiner Flamme gekocht. Hamburg hatte zu der Zeit noch keinen Luftangriff im großen Stil erlebt.
auf kleiner Flamme gekocht. Hamburg hatte zu der Zeit noch keinen Luftangriff im großen Stil erlebt. Im Alsterpavillon spielte Bernhard Été mit seiner Band auf. Als Junge aus der Provinz liefen mir Augen und
Im Alsterpavillon spielte Bernhard Été mit seiner Band auf. Als Junge aus der Provinz liefen mir Augen und Ohren über.
Ohren über. Einmal bekamen wir in Altenwalde das „Fronttheater" zu sehen. Eine von mehreren Truppen, die den Solda-
Einmal bekamen wir in Altenwalde das „Fronttheater" zu sehen. Eine von mehreren Truppen, die den Solda- ten an allen Fronten das Leben „verschönern" sollten. Künstler jeglicher Couleur waren vertreten. Artisten,
ten an allen Fronten das Leben „verschönern" sollten. Künstler jeglicher Couleur waren vertreten. Artisten, Jongleure, Musiker und so weiter. Will Glahé mit seinen Rhythmikern machte die Musik.
Jongleure, Musiker und so weiter. Will Glahé mit seinen Rhythmikern machte die Musik. Es war im Juni, etwa um den 10. herum, ich war in meiner Freiwache mit einem Kumpel nach Cuxhaven ge-
Es war im Juni, etwa um den 10. herum, ich war in meiner Freiwache mit einem Kumpel nach Cuxhaven ge- fahren. Es war ein schöner Sonntag. Einmal bis zur .Alten Liebe", dann ins „Pik As", wo eine Kapelle spielte.
fahren. Es war ein schöner Sonntag. Einmal bis zur .Alten Liebe", dann ins „Pik As", wo eine Kapelle spielte. Für einen Kinobesuch war es zu spät.
Für einen Kinobesuch war es zu spät. Auf dem Heimweg zur Funkstelle trafen wir Funker, die auch in der Stadt, aber dort im Kino gewesen waren.
Auf dem Heimweg zur Funkstelle trafen wir Funker, die auch in der Stadt, aber dort im Kino gewesen waren. „Du, Scheich," sagte einer, „dein Name ist während der Vorstellung, bei einer Unterbrechung, genannt wor-
„Du, Scheich," sagte einer, „dein Name ist während der Vorstellung, bei einer Unterbrechung, genannt wor- den, du solltest sofort zur Funkstelle zurückkommen.“ Was das wohl zu bedeuten hatte?
den, du solltest sofort zur Funkstelle zurückkommen.“ Was das wohl zu bedeuten hatte? In der MPS angekommen meldete ich mich sogleich beim wachhabenden Maat: „Melde dich mal sofort beim
In der MPS angekommen meldete ich mich sogleich beim wachhabenden Maat: „Melde dich mal sofort beim Chef.”
Chef.” Ich rein: „Funkgefreiter Schröder meldet sich zur Stelle."
Ich rein: „Funkgefreiter Schröder meldet sich zur Stelle." „Sie packen ihren Seesack, Reisepapiere sind schon fertig. Morgen früh fahren sie und melden sich beim
„Sie packen ihren Seesack, Reisepapiere sind schon fertig. Morgen früh fahren sie und melden sich beim OKM (Oberkommando der Marine) am Tirpitzufer in Berlin."
OKM (Oberkommando der Marine) am Tirpitzufer in Berlin." Er wünschte mir noch alles Gute und sagte mir dann, dass ich zu einem Sonderkommando in Spanien ver-
Er wünschte mir noch alles Gute und sagte mir dann, dass ich zu einem Sonderkommando in Spanien ver- setzt wurde.
setzt wurde. Von diesem „Verein" trennte ich mich nicht so gerne. Was wollte man machen, es war Krieg. Ich verabschie-
Von diesem „Verein" trennte ich mich nicht so gerne. Was wollte man machen, es war Krieg. Ich verabschie- dete mich am anderen Morgen von meinen Kumpels, schulterte meinen Seesack und los ging es. - Auf ein
dete mich am anderen Morgen von meinen Kumpels, schulterte meinen Seesack und los ging es. - Auf ein Neues.
Neues. Mit dem Bus nach Cuxhaven Bahnhof, schon war ich wieder auf der Schiene, Richtung Hamburg. Zu der Zeit
Mit dem Bus nach Cuxhaven Bahnhof, schon war ich wieder auf der Schiene, Richtung Hamburg. Zu der Zeit waren viele Soldaten unterwegs. In jedem Zug war Feldgendarmerie im Einsatz. Jeder Fahrgast musste sich
waren viele Soldaten unterwegs. In jedem Zug war Feldgendarmerie im Einsatz. Jeder Fahrgast musste sich exakt ausweisen können. Eine Doppelstreife ließ sich die Fahrausweise zeigen.
exakt ausweisen können. Eine Doppelstreife ließ sich die Fahrausweise zeigen. Mit dem Stahlhelm auf dem Kopf und Pistole am Gürtel, dazu noch ein silbrig glänzendes Schild an einer
Mit dem Stahlhelm auf dem Kopf und Pistole am Gürtel, dazu noch ein silbrig glänzendes Schild an einer Kette um den Hals gehängt, machten sie einen martialischen Eindruck (im Volksmund auch „Kettenhunde"
Kette um den Hals gehängt, machten sie einen martialischen Eindruck (im Volksmund auch „Kettenhunde" genannt).
genannt). In Hamburg Hauptbahnhof musste ich umsteigen in einen D-Zug nach Berlin. Der Juni hatte schöne Tage
In Hamburg Hauptbahnhof musste ich umsteigen in einen D-Zug nach Berlin. Der Juni hatte schöne Tage und die mecklenburgische Landschaft prangte im Frühlingsgrün. Vom Zug aus konnte man schon die großen
und die mecklenburgische Landschaft prangte im Frühlingsgrün. Vom Zug aus konnte man schon die großen Funkmasten in Nauen sehen. Jetzt war Berlin nicht mehr weit. Spandau, Anhalter Bahnhof, Endstation, alles
Funkmasten in Nauen sehen. Jetzt war Berlin nicht mehr weit. Spandau, Anhalter Bahnhof, Endstation, alles aussteigen. - Ich war in der Reichshauptstadt.
aussteigen. - Ich war in der Reichshauptstadt. Quelle
Quelle ______________________________________________________________________________________
Willy Seitel: Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
______________________________________________________________________________________
Willy Seitel: Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen - Licht in der Finsternis -
- Licht in der Finsternis - Im Jahr des Unheils 1915, im Frühling, erfuhr man, ein Torpedobootzerstörer sei zwischen Helgoland und
Im Jahr des Unheils 1915, im Frühling, erfuhr man, ein Torpedobootzerstörer sei zwischen Helgoland und Cuxhaven auf eine Treibmine aufgefahren. Die Hälfte der Besatzung fiel der Explosion selbst zum Opfer, die
Cuxhaven auf eine Treibmine aufgefahren. Die Hälfte der Besatzung fiel der Explosion selbst zum Opfer, die andere Hälfte wurde zum Teil noch schwimmend geborgen, und zwar durch ein zufällig vorbeikreuzendes
andere Hälfte wurde zum Teil noch schwimmend geborgen, und zwar durch ein zufällig vorbeikreuzendes Schulschiff.
Schulschiff. Unter diesen in letzter Minute Geretteten befand sich auch ein gewisser Leichtmatrose namens Max Ziehlke,
Unter diesen in letzter Minute Geretteten befand sich auch ein gewisser Leichtmatrose namens Max Ziehlke, der, kaum ins Trockene gebracht, einer tiefen Bewußtlosigkeit verfiel. Diese vollständige Apathie und
der, kaum ins Trockene gebracht, einer tiefen Bewußtlosigkeit verfiel. Diese vollständige Apathie und Schockwirkung war so kräftig, daß er noch im Lazarett in Berlin eine Woche nachher in tiefem Schlafe lag.
Schockwirkung war so kräftig, daß er noch im Lazarett in Berlin eine Woche nachher in tiefem Schlafe lag. Man hatte seine Eltern noch nicht verständigt, da deren Besuch zunächst völlig zwecklos schien.
Man hatte seine Eltern noch nicht verständigt, da deren Besuch zunächst völlig zwecklos schien. ______________________________________________________________________________________
Seite 4
______________________________________________________________________________________
Seite 4